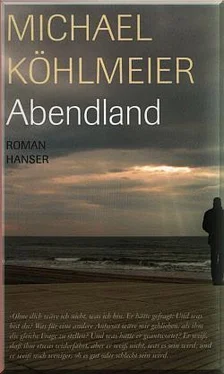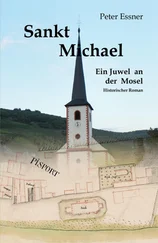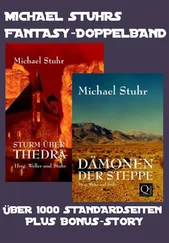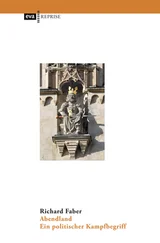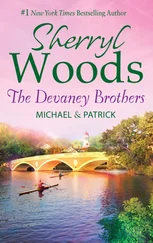Die Zuhörer waren begeistert; begeistert von der Virtuosität und der Vielfalt der musikalischen Einfälle und sicher auch von der sperrigen Erscheinung meines Vaters. Carl aber war tief berührt, und er wäre, wie er sagte, gern allein gewesen und hätte Stille um sich gehabt. Nie vorher habe er einen Musiker gehört, dem es in solcher Vollkommenheit gelungen sei, Ton und Empfindung in eins zu setzen. Nicht Musik aus Musik habe er gehört; Bezugnahme auf andere Gitarristen, Zitate aus anderen Stücken, wie sie bei den Improvisationen des Bebop üblich waren, gab es in dieser Musik nicht.»Ich hatte das angenehm unangenehme Gefühl, doch so etwas wie eine Seele zu besitzen«, erzählte Carl immer wieder — mein Vater wand sich vor Verlegenheit, wenn er mithörte; sicher war er auch stolz, vor allem aber war er ungeduldig, weil es immer das gleiche war, was ihm an Lob geboten wurde, und nicht einmal eine kleine Steigerung oder wenigstens eine neue überraschende Wendung.»Es war, als ob er zu uns spräche, ohne Umweg, sogar ohne den Umweg über die Musik, so paradox das klingen mag. Nicht zu einem Publikum sprach er. Publikum ist überall. Publikum ist ein Begriff, der gleichmacht. Jeder im Club durfte sich sagen: Er spricht zu mir, in Wahrheit spricht er nur zu mir. Und jeder hat ihn verstanden. Da saßen Franzosen, Amerikaner, Briten, Österreicher, Ungarn, Tschechen, und ich versichere euch, hätte sich einer der Mühe unterzogen, jeden einzelnen nach dem Konzert zu bitten, er möge aufschreiben, was der Bursche vorne auf der Bühne hinter der komischen Gitarre seiner Meinung nach erzählt habe, man hätte hinterher einen Packen Papier in der Hand gehalten, beschrieben in einem halben Dutzend Sprachen, aber auf jedem Blatt wäre die gleiche Geschichte gestanden.«
Nachdem er ihn drei Abende hintereinander gehört hatte, trat Carl vor meinen Vater hin, stellte sich vor und sagte etwas Verhängnisvolles, nämlich: Er kenne nur einen, der auf der Gitarre ebenso unmittelbar zu den Menschen spreche, nämlich Django Reinhardt. Den Namen dieses Gitarristen hatte mein Vater schon gehört, seine Musik aber noch nicht. Also lud ihn Carl zu sich nach Hause ein und spielte ihm auf dem elektrischen Grammophon eine Aufnahme des Quintette du Hot Club de France mit Django Reinhardt auf der Gitarre und Stéphane Grappelli auf der Geige vor. Und wie hat mein Vater darauf reagiert? So: Er war empört. Er war beleidigt. Er war eifersüchtig. Er war verzweifelt. Die Tränen standen ihm in den Augen. — Ich kann mir gut vorstellen, wie das aussah, ich habe ähnliche Momente erlebt: Seine Augen waren alt, kalt, reglos wie immer, aber die Tränen stiegen in ihnen auf, als würden sie aus dem Körper nach oben gepumpt. — Was der Herr Doktor damit bezwecke, ihm so etwas vorzuspielen, fragte er. Was für ein Vergnügen es dem Herrn Doktor bereite, ihm zu erzählen, daß dieser Zigeuner eine kaputte Griffhand habe? Ob ihn der Herr Doktor demütigen wolle? Ob er ihm damit sagen wolle, es habe keinen Zweck, wenn er weiter Läufe und Akkordfolgen übe, weil der mit nur einer halben Hand so viel besser spiele? Und so weiter. Carl war perplex. Aber er sah meinem Vater an, daß die Gedanken in seinem Kopf uferlos geworden waren, daß er verzweifelte, als hätte Django Reinhardt mit dieser knapp vier Minuten dauernden Improvisation über Tschaikowskys Pathétique ihm alle Zukunft genommen.»Django Reinhardt ist der Beste«, habe Carl gestammelt,»und Sie sind genauso gut wie er! Ist es denn eine Schande, so gut wie Django Reinhardt zu sein?«Er habe sich gedacht, er müsse angeben, müsse sich aufplustern, erzählte Carl, sonst höre dieser närrische Bursche mit dem Körper eines Kindes und den Augen eines alten Mannes nicht auf ihn.»Ich mußte ihn doch irgendwie überzeugen, daß meine Begeisterung Wert hat!«Er herrschte ihn mit Befehlsstimme an:»Hören Sie zu! Ich darf mit ruhigem Gewissen von mir behaupten, ein wirklich exzellenter Jazzkenner zu sein, und was ich sagen will, ist folgendes: Ich habe fast ein Jahr in New York gelebt, ich kenne alle Clubs dieser Stadt, ich habe Lester Young auf seinem Tenor spielen hören, allein und mit Count Basie, habe Billie Holiday singen hören und habe Fletcher Henderson die Hand gegeben. Ich war einer der wenigen Weißen, die im Savoy in Harlem Zutritt hatten, und ich war dort an dem Tag, als es geschlossen wurde. Sie können mir also glauben, ich habe viele Gitarristen gehört, die etwa in Ihrem Alter sind, Herr Lukasser. Ich habe Barney Kessel gehört und Teddy Bunn, Jimmy Shirley und George Barnes, aber keiner von denen — nicht einer! — hat auch nur annähernd soviel Talent wie Sie!«
Von den genannten Gitarristen hatte mein Vater noch nie etwas gehört.»Wenn sie nicht so gut sind wie ich, brauche ich sie nicht zu kennen.«
«Sie sind nicht so gut.«
«Wirklich nicht?«
«Wirklich nicht.«
«Aber sie spielen in New York.«
«Aber sie sind nicht so gut wie Sie, und sie werden es nie sein.«
«Und diesen Zigeuner, den haben Sie auch spielen gesehen?«
«Ja, natürlich. Vor dem Krieg in Paris.«
«Und auf der Bühne ist er nicht schlechter als auf der Schallplatte?«
«Er ist auf der Bühne besser.«
«Noch besser!«schrie mein Vater auf.»Sogar noch besser! Und ich? Was bin ich? Was kann ich neben dem schon sein?«
Bestenfalls, dachte Carl, kann er nicht logisch denken, schlimmstenfalls ist er paranoid.
Aber er hatte einen Narren an meinem Vater gefressen; und er sah es als seine Aufgabe an, die außerordentliche Begabung dieses jungen alten Mannes zu fördern, diesen außerordentlich komplizierten und — das war ihm schon nach dem ersten Gespräch überdeutlich klar geworden — zerstörerischen Charakter vor der Welt und vor sich selbst zu beschützen. Meine Mutter, die lange ein — um es vorsichtig auszudrücken — distanziertes Verhältnis zu Carl hatte (und erst nach dem Tod meines Vaters unter seinen Einfluß geriet), war immer der Meinung gewesen, Carl bediente sich des Talents meines Vaters, um sich damit zu schmücken und seine eigene allumfassende Talentlosigkeit für sich selbst erträglicher zu machen. Damit hatte sie nicht unrecht; Carl hätte ihr zugestimmt. Aber sein lebenslanges Interesse, seine Treue, ich darf sagen, seine Liebe zu meinem Vater sind damit natürlich nicht erklärt. Ich habe mich oft gefragt, worüber die beiden eigentlich redeten, wenn sie nicht über Musik redeten. Von meinem Vater wußte ich, daß er über alles redete, außer über Musik, daß er zu allem eine Meinung hatte, außer zur Musik. Das meiste war Quatsch, was er redete, halbwahr und von seinen Vorurteilen diktiert. Also worüber redeten die beiden?
3
Carl hatte gute Kontakte zu den Amerikanern in Wien. Er verschaffte meinem Vater Auftritte in allen wichtigen Jazzclubs der Stadt, und überall war man überwältigt von der Fulminanz dieses Wunderkindes. Tatsächlich war die Synthese aus Wienerlied, Swing und Bebop und die eigentümliche Spielweise auf diesem eigentümlichen Instrument etwas im Wortsinn Unerhörtes. Und dann geschah ein Wunder: Die amerikanische Jazz-Zeitschrift down beat wurde auf meinen Vater aufmerksam. Wie es dazu gekommen war, weiß ich nicht, und Carl weiß es auch nicht — behauptete er; jedenfalls sei eines Abends John Maher persönlich, der Herausgeber des Magazins, im Embassy-Club aufgetaucht und habe sich meinen Vater angehört. Am Schluß jauchzte er und trampelte mit den Füßen, zeigte seine Zähne, raufte sich den Hosenbund bis unter die Brustwarzen und fragte, wer der Manager dieses Magiers sei, und der Clubbesitzer führte ihn — als bestehe nicht der geringste Zweifel — zu Carls Tisch. Maher schlug vor, Carl solle meinen Vater für down beat interviewen. So war der Name Georg Lukasser zum erstenmal in Amerika zu lesen.
In diesem Interview erzählte mein Vater sonderbare Dinge; das heißt, was er erzählte, war weniger sonderbar als die Art, wie er es erzählte: sprunghaft, in derben Worten, ressentimentgeladen, fanatisch; Großes wie Krieg und Frieden kommentierte er mit dünnen dümmlichen Phrasen, auf unwichtige Dinge dagegen ging er akribisch ein, so zum Beispiel, wenn er beschrieb, wie sich der alte, hochverehrte, weißmähnige, weißbärtige, griesgrämige Contragitarristenkönig Anton Strohmayer vor seinen Auftritten die Fingernägel gefeilt habe. Carl notierte den Sermon, sorgte bei der Reinschrift dafür, daß die Sätze halbwegs den grammatikalischen Regeln folgten, beließ aber, ja, verstärkte sogar, wie er später zugab, die skurrilen Eigenheiten und übersetzte schließlich alles ins Englische. Es war die Zeit, als der Swing in Amerika klassisch wurde und der Bebop zu einer explosiven Blüte ansetzte; wer selbst nicht mitspielen konnte, schrieb darüber, aus jedem Rülpser eines Ben Webster, eines Charlie Parker, eines Max Roach oder eines Dizzy Gillespie wurde eine Philosophie gezopft, die verminderte Quint wurde als akustische Ikone jenes Lebensgefühls gefeiert, das die Franzosen wenig später Existentialismus nannten, und alle waren auf der Suche nach originalen — eben sprunghaften, derben, ressentimentgeladenen, fanatischen — Genies, die nicht zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem unterscheiden wollten und, wenn möglich, Autodidakten waren. Im Bebop herrschte das Tenorsaxophon, aber das Tenor bot den federführenden Feinspitzen inzwischen nur noch wenig Überraschung, die Gitarre schob sich ins Zentrum ihres Interesses — Charlie Christian wurde wiederentdeckt, Django Reinhardt war in New York wie ein Gott gefeiert worden. Für die Amerikaner war Österreich, falls sie überhaupt etwas über dieses Land wußten, ein dumpf-bäuerlicher Hinterwald, aus dem Adolf Hitler gekrochen war, um Europa anzuzünden, und wenn von dort Nachricht über einen Jazzer eintraf, war das mehr als nur exotisch. In der amerikanischen» Fachwelt «löste das Interview großes Interesse aus. Art Hodges, selbst Pianist und nebenbei Mitherausgeber der Konkurrenzzeitschrift Jazz Record , schrieb im folgenden Heft von down beat einen Gastkommentar über europäischen Jazz, und in einem Absatz ging er auf meinen Vater, diesen» neuen Stern mit dem komischen Instrument«, ein und forderte Aufnahmen. Der Mann solle nach New York kommen, schrieb er; wenn es für Künstler wie ihn auf dieser Welt einen Platz gebe, sei der hier und nirgendwo sonst. Obendrein meldete sich auch noch das exklusive Jazz Label Blue Note beim» Manager «meines Vaters. Carl hatte in den dreißiger Jahren in New York das Entstehen einer unabhängigen Studio- und Vertriebsszene miterlebt, er war oft in Milton Gablers legendärem Commodore Music Shop in der 44. Straße gewesen, aus dem Blue Note Records hervorgegangen waren, und hatte dort sehr viel Geld für Schallplatten liegenlassen. Er riet meinem Vater dringend, die Einladung anzunehmen, selbstverständlich würde er für alle Kosten aufkommen, und wenn er es wünsche, werde er ihn begleiten. Mein Vater aber wehrte ab. Nicht, weil er sich von Carl nicht aushalten lassen wollte. Und sicher nicht, weil er sich vor der großen Stadt fürchtete. Er fühlte sich nicht reif genug für eine Schallplattenaufnahme. Es dauerte noch eine Weile, bis es soweit war; und dann spielte er nicht mehr auf der Contragitarre — nie mehr — natürlich» nie mehr«; lauwarme Zwischenzustände wie» manchmal «oder» selten «oder» ab und zu «oder» bisweilen «kannte mein Vater nicht; für ihn gab es nur: immer oder nie.
Читать дальше