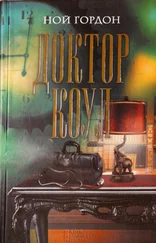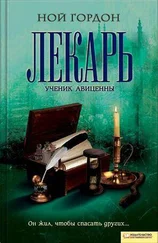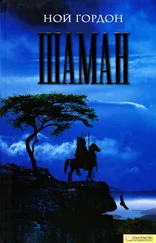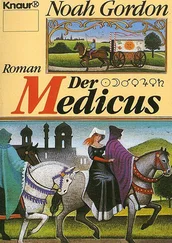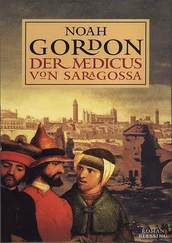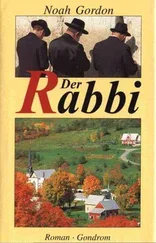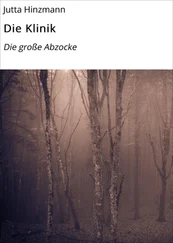Eines Abends kam Sack herein und nickte ihnen zur Begrüßung zu. Er sagte wenig, aber statt wieder zu gehen, zog er einen Stuhl herbei und sah ihnen zu. Zwei Abende später kam er wieder, und diesmal bat er Adam, als sie fertig waren, in sein Büro zu kommen.
»Wir könnten eine stundenweise Hilfe in der Pathologischen Abteilung des Krankenhauses brauchen«, sagte er. »Wollen Sie uns helfen?«
Die Arbeit würde bei weitem nicht so viel einbringen wie die Nachtarbeit in der Unfallstation in Woodborough, aber sie würde auch nicht so an seinen Kräften zehren oder seinen wertvollen Schlaf so stark beschneiden. »Ja«, sagte er ohne Zögern.
»Jerry Lobsenz hat gute Arbeit an Ihnen geleistet. Könnten wir Sie vielleicht nächstes Jahr in die Pathologie lokken?«
Langsam kamen die Angebote, ein Zeichen, daß der Kampf zu Ende war. »Leider nein.«
»Die Bezahlung nicht hoch genug?«
»Stimmt zum Teil, aber nicht ganz. Ich möchte es nicht hauptberuflich machen.« Es lag nicht im Plansoll Silver-stones.
Sack nickte. »Nun, Sie sind diesbezüglich wenigstens ehrlich. Lassen Sie es mich wissen, sollten Sie es sich je anders überlegen.«
Er hatte also wenig Grund, das Krankenhaus zu verlassen. Die alten Backsteingebäude wurden seine Welt. Seine Stunden in der Pathologie waren unregelmäßig, aber nicht unangenehm. Es machte ihm Spaß, allein in der summenden Stille des weißen Labors in dem Bewußtsein zu arbeiten, daß es eine Umwelt war, in der einige Leute zusammenklappten, er jedoch wieder einmal imstande war, Höchstleistungen zu vollbringen.
Er teilte seine Freizeit zwischen der Pathologie und dem Tierlabor, wo er sehr viel von Kender lernte. Die Verschiedenheit der beiden Männer, die ihn das meiste gelehrt hatten, verblüffte ihn.
Lobsenz war ein kleiner, introspektiver Jude gewesen, mit einem leichten deutschen Akzent, der nur dann hörbar wurde, wenn er müde war. Und Kender ...
Kender war eben Kender.
Aber vielleicht hatte er sich zuviel vorgenommen. Zum erstenmal im Leben schlief er regelmäßig schlecht und träumte wieder, nicht den Hochofentraum, sondern den Tauchertraum.
Zu Beginn des Traums kletterte er immer die Leiter in das gleißende Sonnenlicht hinauf. Es war sehr realistisch: er spürte die Kühle des Stahlgerüsts in seinen Händen vibrieren, wann immer es vom Wind getroffen wurde. Der Wind setzte ihm zu. Im Klettern schaute er unentwegt zu der oberen Plattform hinauf, wo die Leiter hoch über ihm wie eine Bleistiftspitze immer schmäler wurde, bis seine Augen in der Sonne zu tränen begannen und er sie schließen mußte. Er blickte nie hinunter. Wenn er schließlich die Plattform erreichte, schaute er mit angespannten Sitzbacken und trockenem Mund in die Welt hinaus, die sich dreißig Meter tief unter ihm dehnte. Die Plattform schwankte und zitterte im Wind, das Schwimmbecken unten blitzte winzig und hart in der Sonne, mehr eine Hundemarke als ein Fangnetz. Er trat von der Plattform ins Leere hinaus, ließ den Kopf zurückfallen, breitete die Arme aus, als sein Körper sich hoch, hoch in der Luft drehte, während der Wind sich in ihm wie in einem Segel fing, ihn stieß, sein Gleichgewicht störte, ihn von seinem Kurs abdrängte. Er versuchte verzweifelt, es wettzumachen, weil er wußte, daß er das Becken ebensogut völlig verfehlen wie schlecht landen konnte, nur nicht an der tiefsten Stelle, wo das Wasser drei Meter tief als Stoßkissen wirkte. Er würde schlecht landen, dachte er dumpf, während er grotesk in der Luft hing und das Wasser auf ihn zuraste. Er würde sich verletzen, und er würde nie Chirurg werden.
O Gott.
Der Traum endete immer auf halbem Weg zwischen der Spitze des Sprungturms und dem Wasser. Wenn er erwachte und in der Finsternis lag, sagte er sich, daß er nie wieder etwas so Törichtes tun würde, daß er ja bereits Chirurg sei, daß ihn jetzt nichts mehr aufhalten würde.
Warum kam der Traum immer wieder?
Er konnte keine Ursache finden, bis er eines Nachts in der Pathologie die Augen schloß, tief atmete und durch einen Geruch, der herben Essenz von Formaldehyd, über Zeit und Raum hinweg in das Pathologie-Labor Lobsenz' versetzt wurde, wo er den Tauchertraum zum erstenmal geträumt hatte.
Es war in seinem dritten Jahr an der Medizinischen Schule in Pennsylvanien gewesen, in der Zeit seiner größten finanziellen Schwierigkeiten.
Die Schande und der Ekel vor der alternden Geliebten und ihren Almosen lagen hinter ihm. Das Kohlenschaufeln hatte ihn durch den kalten Winter gebracht und versorgte ihn bis zum Frühjahrsbeginn; dann aber begann er regelmäßig während des Unterrichts einzuschlafen und mußte die Arbeit aufgeben, denn hätte er sie behalten, wäre er aus zwei Kursen ausgeschieden worden. Er gewöhnte sich so sehr an die Verzweiflung, daß er sie die meiste Zeit zu ignorieren vermochte. Seine Schulden waren auf sechstausend Dollar Studentenanleihe angewachsen. Er war mit seiner Miete im Rückstand, aber die Hausfrau war bereit, zu warten. Er strich das Mittagessen mit der Begründung, daß er ohnehin zuviel aß, und zwei Wochen lang überfiel ihn mittags Hunger, nachmittags Schwäche, dann aber machte er von Anfang April bis Mitte Mai Dienst im Krankenhaus und bekam das Stationsessen umsonst, indem er den richtigen Schwestern schöntat.
Im Juni erwog er, eine Stellung als chirurgischer Techniker anzunehmen, mußte jedoch mit Bedauern erkennen, daß er das nicht konnte: bei der mageren Bezahlung hätte er nicht genug sparen können, um das Abschlußjahr an der Medizinischen zu überleben. Schon begann er zu erwägen, in den Kurort in den Poconos zurückzukehren, als er eine winzige Annonce imPhiladelphia Bulletin sah, in der Berufstaucher für eine Wassershow am Strand von Jersey gesucht wurden. Barneys Aquacade war mit zwei Filipinos und einem Mexikaner eine Attraktion der Seepromenade, aber sie brauchten fünf Taucher für die Show, und Adam war einer der beiden College-Taucher, die angestellt wurden. Die Bezahlung betrug fünfunddreißig Dollar pro Tag, sieben Tage in der Woche. Obwohl er noch nie dreißig Meter tief gesprungen war, fiel es ihm nicht schwer, richtig zu tauchen: einer der Filipinos zeigte ihm in unzähligen Trockenläufen, wie er, sobald er auf die Oberfläche des Schwimmbeckens traf, die Arme zurückwerfen und die Knie an die Brust ziehen mußte, so daß er die drei Meter Wasser in einem Bogen hinunterglitt und schließlich sanft auf dem Grund aufsetzte. Als er zum erstenmal auf dem Turm stand, war die Höhe das Schlimmste an dem Erlebnis.
Die Stahlleiter fühlte sich zu glatt, fast schlüpfrig an, unmöglich, sie im Griff zu behalten. Er kletterte sehr langsam und versicherte sich jedesmal, ob er auch eine Hand fest um eine Sprosse geschlossen hatte, bevor er die andere Hand losließ und seinen Fuß höher setzte. Er versuchte, geradeaus zu schauen, zum Horizont, aber die große untergehende Sonne war noch immer da, und sie erschreckte ihn, ein goldenes böses Auge - er hielt in seinem Aufstieg inne, hängte sich mit der Armbeuge fest um eine Sprosse und machte mit den Fingern das Zeichen der Teufelshör-ner,scutta mal occhio, pf, pf, pf - dann blickte er entschlossen hinauf und heftete seinen Blick auf die hohe Plattform, die, während er kletterte, mit tödlicher Langsamkeit immer größer wurde und näher rückte, die er aber endlich doch erreichte. Als seine Füße auf der Plattform standen, fiel ihm das Loslassen der Leiter und das Umdrehen sehr schwer, aber es gelang ihm.
Die Höhe betrug, wußte er, nicht mehr als fünf Stockwerke, aber sie erschien ihm höher; zwischen ihm und der Wasseroberfläche lag nichts, und alle Gebäude der Umgebung hockten dicht am Boden. Er stand auf seinem Horst und schaute nach rechts, wo die Seepromenade endete, die Küste abfiel und einen Bogen beschrieb, und nach links, wo weit weg und tief unten winzige Wagen über die Gleise einer Hochschaubahn krochen.
Читать дальше
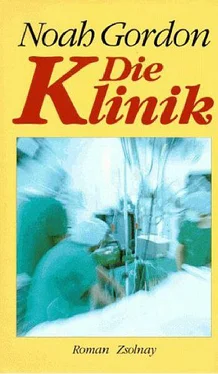
![Ной Гордон - Лекарь. Ученик Авиценны [litres]](/books/24255/noj-gordon-lekar-uchenik-avicenny-litres-thumb.webp)