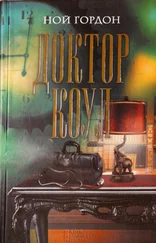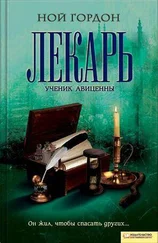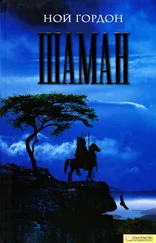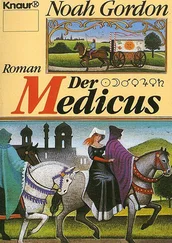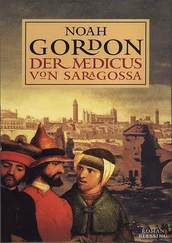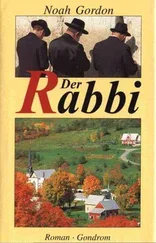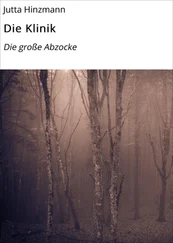»Ich bin eine geschiedene Frau.«
»Geschieden von jemandem im besonderen?«
Sie zog ihre Hand zurück, aber das Lächeln blieb. »Von niemandem im besonderen.«
Er sah seine Mutter durch die Tür kommen, sie sah viel kleiner aus als gestern und bewegte sich viel langsamer, als sie sich einst bewegt hatte.
»Mama«, sagte er und stand auf. Als sie herüberkam, stellte er sie einander vor. Dann verabschiedete er sich höflich von dem Mädchen und verließ langsam das Kaffeehaus, seinen Schritt dem seiner Mutter anpassend.
Bei ihren späteren Krankenhausbesuchen suchte er das Mädchen, aber sie war nicht im Kaffeehaus; die Freiwilligen arbeiteten unregelmäßig und kamen mehr oder weniger, wann sie wollten. Er hätte ihre Telephonnummer finden können - aber er nahm sich nicht einmal die Mühe, das Buch aufzuschlagen. Die Arbeit im Krankenhaus war sehr schwer, und der sich verschlimmernde Zustand seiner Mutter lag mit jedem Tag schwerer auf seinen Schultern. Ihr Fleisch schien dünner und durchsichtiger zu werden, sich fester über das zarte Rahmenwerk ihrer Knochen zu spannen. Ihre Haut entwickelte eine leuchtende Helligkeit, die er für den Rest seines Lebens bei Krebskranken sofort erkennen sollte, wann immer er sie sah.
Sie sprach jetzt öfter von Kuba. Manchmal, wenn er heimkam, fand er sie im Zimmer am Fenster sitzen und auf den Verkehr hinunterschauen, der leise über die Ar-lington Street glitt.
Was sah sie, fragte er sich: Kubanische Gewässer? Kubanische Wälder, kubanische Felder? Gesichter von Geistern, von Menschen, die er nie gekannt hatte?
»Mamacita«, sagte er eines Abends, unfähig zu schweigen. Er küßte ihren Scheitel. Er wollte die Hand ausstrek-ken, ihr Gesicht streicheln, sie sanft an sich ziehen, seine Arme um sie legen, damit nichts sie erreichen und alles, was ihr schaden konnte, zuerst durch ihn hindurchgehen mußte. Aber er fürchtete, daß er sie erschrecken würde, daher tat er nichts von alledem.
Nach sieben Wochen hatten sich Aspirin und Kodein als unwirksam erwiesen. Der Krebsarzt ersetzte diese Mittel durch Demerol.
Elf Wochen später brachte sie Rafe wieder in das hübsche sonnige Zimmer im Phillips House des Massachusetts General Hospital. Reizende Schwestern füllten ihre Venen regelmäßig mit der Gabe der Mohnblumen.
Zwei Tage, nachdem seine Mutter in Koma verfiel, sagte ihm der Krebsspezialist gütig, aber sachlich, er könne zwar weiterhin einiges unternehmen, um das Funktionieren ihrer lebenswichtigen Organe zu verlängern, er könne aber auch damit aufhören, so daß sie ziemlich schnell sterben würde.
»Wir sprechen nicht von Euthanasie«, sagte der alternde Arzt. »Wir sprechen von dem Entschluß, ein Leben zu stützen, in dem keine Hoffnung mehr auf ein wirkliches Leben besteht; nur Perioden schrecklicher Schmerzen. Ich treffe diesen Entschluß nie allein, wenn ein Verwand-ter vorhanden ist. Überlegen Sie es sich. Es ist ein Entschluß, vor dem Sie als Arzt immer wieder stehen werden.«
Rafe brauchte nicht lange zu überlegen. »Lassen Sie sie gehen«, sagte er.
Als er am folgenden Morgen das Krankenzimmer seiner Mutter betrat, sah er einen dunklen Schatten über sie gebeugt, einen großen mageren Priester, dessen sommersprossiges Babygesicht und Karottenhaar über seiner schwarzen Soutane wie ein Witz wirkten.
Schon schimmerte Öl auf den Augenlidern seiner Mutter und spiegelte winzige Lichtfünkchen.
»... Möge dir der Herr deine Sünden vergeben, welche immer du begangen hast«, sagte der Priester soeben; sein in Weihwasser getauchter Daumen machte das Kreuzzeichen auf ihrem verzerrten Mund, seine Stimme war ein Greuel, ärgster Südbostoner Akzent.
Du ungesund nüchterner junger Mann, was für ernsthafte Sünden konnte sie schon begangen haben, fragte sich Rafe. Wieder wurde der jugendliche Daumen eingetaucht. »Durch diese Heilige Ölung .«
Gott, es heißt, es gäbe dich nicht, denn, wenn du existiertest, würdest du uns dann so quälen? Ich liebe dich, Mutter. Stirb nicht. Ich liebe dich. Bitte.
Aber laut sagte er nichts.
Er verharrte am Fußende des Bettes seiner Mutter und fühlte sich plötzlich allein, eine gräßliche Isolierung, und wußte, daß er nichts als ein Fleckchen Taubenmist in der grauenhaften Leere war.
Bald darauf bemerkte er, daß sie nicht mehr atmete. Er ging zu ihr, schob die Hand des Priesters mit einem Achselzucken beiseite, und nahm sie in die Arme.
»Ich liebe dich. Ich liebe dich. Bitte.« Seine Stimme war laut in dem stummen Zimmer.
Seine Mutter ging in kostspieligem, aber einsamem Prunk dahin. Rafe veranlaßte, daß sie in Blumen schwamm. Der Sarg war ein kupferner Cadillac, mit blauem Samt austapeziert. Das Letzte, das er noch für sie tun konnte, war, die feierliche Seelenmesse in der Cäcilienkirche zu bezahlen. Guillermo und Onkel Erneido flogen von Miami her. Die Wirtschafterin und das Zimmermädchen aus dem Ritz kamen und saßen in der letzten Reihe. Ein zitternder Trunkenbold, der vor sich hinmurmelte und zu den falschen Zeiten niederkniete, saß allein in der Ecke, vier Sitze vom Meßner entfernt. Ansonsten war die St.-Cäcilia-Kirche völlig leer, ein poliertes Echo, das nach Bodenwachs und Weihrauch roch.
Am Grab in Brookline standen sie allein, fröstelnd vor Kummer und Angst und der bis in die Knochen dringenden Kälte. Als sie zum Ritz-Carlton zurückkehrten, entschuldigte sich Erneido und ging mit Kopfschmerzen und Pillen zu Bett. Rafe und Guillermo zogen sich in die Hotelhalle zurück und tranken Scotch. Es war wie in den schlimmen alten Zeiten: trinken und Guillermo nicht zuhören. Schließlich verstand er durch einen Alkoholdunst wie aus der Ferne, daß Guillermo ihm etwas höchst Wichtiges erzählte.
». geben uns Waffen, Flugzeuge, Panzer. Schulen uns ein. Sie werden Schulter an Schulter mit uns kämpfen, diese Marinesoldaten sind wundervolle Kämpfer! Wir werden Deckung aus der Luft haben, wir werden jeden Offizier brauchen, du wirst mit jedem, den du kennst, Kontakt aufnehmen müssen. Ich bin Hauptmann. Auch du wirst zweifellos Hauptmann werden.«
Rafe konzentrierte sich, erkannte, worüber sein Bruder sprach, und lachte freudlos. »Nein«, sagte er. »Danke.«
Guillermo hörte zu reden auf und sah ihn an. »Was meinst du damit?«
»Ich brauche keine Invasionen. Ich gedenke hierzubleiben. Ich werde um die amerikanische Staatsbürgerschaft ansuchen.«
Sechzig Prozent Entsetzen, dreißig Prozent Haß, zehn Prozent Verachtung rechnete er, als er die verschleierten Meomartino-Augen seines Bruders beobachtete.
»Du glaubst nicht an Kuba?«
»Glauben?« Rafe lachte. »Ich werde dir die Wahrheit sagen, großer Bruder. Ich glaube an überhaupt nichts, nicht so, wie du meinst. Ich glaube, daß alle ideologischen Bewegungen, alle großen Organisationen dieser Welt Lügen und Profit für irgend jemanden sind. Vermutlich glaube ich nur an Menschen, die anderen Menschen so wenig wie möglich schaden.«
»Edel. Was dir fehlt, ist Mut.«
Rafe starrte ihn an.
»Du hast nie welchen gehabt.« Guillermo stürzte seinen Drink hinunter und schnalzte mit den Fingern nach dem Kellner. »Ich habe Mut, genug für alle Meomartinos. Ich liebe Kuba.«
»Du redest nicht über Kuba,alcahuete.« Sie hatten spanisch gesprochen; plötzlich entdeckte Rafe, daß er aus unerfindlichen Gründen in Englisch verfallen war. »Du redest über Zucker, Kuba ist nur das Alibi. Was wird es schon den armen Schweinen helfen, die das wirkliche Kuba sind, wenn wir Fidel in dennalgas zum Teufel jagen und uns alle unsere Schätze zurückholen?« Wütend nahm er einen Schluck Scotch. »Würde sie einer, den wir an sei-ne Stelle setzen, anders behandeln? Niemals«, beantworte er seine eigene Frage. Zu seinem Verdruß merkte er, daß er zitterte.
Guillermo wartete, bis er ausgesprochen hatte.
Читать дальше
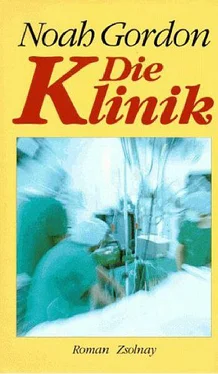
![Ной Гордон - Лекарь. Ученик Авиценны [litres]](/books/24255/noj-gordon-lekar-uchenik-avicenny-litres-thumb.webp)