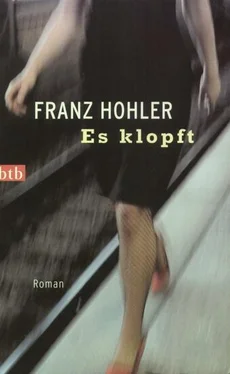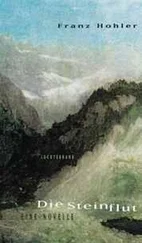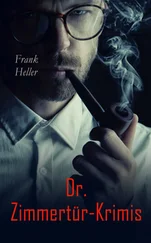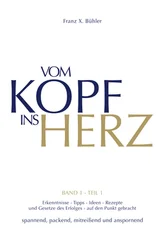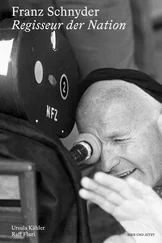Sein Patient lachte nicht mehr. »Dann muss man operieren?« fragte er.
Das mache man nur, wenn Veränderungen der Gefäße oder der Ohrmuskulatur die Ursache seien, da Herr Simonett aber nicht über Schwindel klage und das Geräusch auch nicht mit dem Puls synchron gehe, sehe es nicht nach einem objektivierbaren, sondern nach einem subjektiven Tinnitus aus, der eben durch eine Art Fehlverhalten des Informationssystems des Ohres entstehe.
Der junge Mann war besorgt. Ob man denn dieses Fehlverhalten nicht korrigieren könne?
Man könne es versuchen, und er würde ihm raten, darüber nachzudenken, ob der dauernde Stress, unter dem er stehe, nicht vielleicht doch zuviel von ihm verlange und ob es allenfalls innerhalb der Bank eine andere Stelle gebe, die ihn weniger belaste.
»Aber mir gefällt der Job!« rief der Mann, und sein Gesichtsausdruck nahm etwas Verstörtes an, »gerade das Tempo, das es braucht!«
Er könne auch nicht auf Anhieb sagen, ob das die Lösung wäre –
Was denn aber die Lösung sei, fragte der Patient, von den Aussagen seines Arztes sichtlich in die Enge getrieben.
Eine Lösung könne z.B. auch darin bestehen, dass man versuche, mit dem Geräusch zu leben und Maßnahmen zu ergreifen, die dazu führten, dass man es nicht mehr als dermaßen störend empfinde.
Wie denn solche Maßnahmen aussähen, fragte Simonett.
Man könne versuchen, dieses Geräusch durch andere Geräusche zu maskieren, also wenn er z.B. neben einer Eisenbahnlinie wohnen würde, würde er ein Eisenbahngeräusch in seinem Ohr weniger befremdlich finden.
Herrn Simonetts Augen weiteten sich. Ob das ein Scherz sei, fragte er.
Keineswegs, sagte ihm Dr. Manuel Ritter, in diese Richtung könnten entsprechende Maßnahmen durchaus gehen. Natürlich könne man sich auch durch Musik im Frequenzbereich der jeweiligen Störung oder durch andere Schalleffekte wie weißes Rauschen ablenken, er werde ihn jedenfalls gerne an einen Kollegen überweisen, dessen Spezialgebiet der Tinnitus sei und wo dann ganz genau abgeklärt werde, was in seinem Fall die Ursachen sein könnten, welche, wie gesagt, durchaus auch psychischer Natur sein könnten, er würde diesem einen kurzen Bericht zukommen lassen, und sein Reintonaudiogramm könne er, Herr Simonett, ihm selbst mitbringen oder er könnte es ihm auch mailen, falls er dies wünsche. Dr. Mannhart sei eine Kapazität auf diesem Gebiet, den er nur empfehlen könne.
Gut, sagte Simonett kleinlaut, gut, dann werde er sich dort anmelden. Er wolle bei der Bank bleiben und könne keine Eisenbahnzüge im Ohr brauchen.
Als der Patient das Sprechzimmer verlassen hatte, mit einem Schritt, der etwas weniger federnd war als beim Eintreten, blieb Manuel einen Moment sitzen und dachte nach.
Da klopfte es an die Tür, genau gleich, wie es schon heute Nacht und am Mittag geklopft hatte, drei schnelle Schläge. Er zuckte zusammen, reagierte aber weder mit einem »Herein!« noch damit, dass er zur Türe ging. Das hätte auch wenig geholfen, denn soeben war ihm klar geworden, woher das Klopfen kam, und er wunderte sich, wieso ihm das nicht früher in den Sinn gekommen war.
Er nahm den Hörer in die Hand, drückte die Nummer eins und bat Frau Weibel, ihn mit Dr. Mannhart zu verbinden.
Also«, sagte Mirjam, »vierter Akt, zweite Szene. Wir drehen eine Seite des großen Buches um, das stünde hier, und auf der linken Seite oben steht ›Ein Garten‹, darunter malt uns Benno einen Garten, der über beide Seiten des Buches geht, Vinz spielt uns ein überbordendes Vogelgezwitscher ein, und nun öffnet sich die Tür in der Seite, und die Gouvernante schiebt Lena auf so ’ner fahrbaren Bahre herein, wie man sie in Spitälern hat. Sie bleibt etwa in der Bühnenmitte stehen, das wäre hier, wo wir diese zwei Bänke hingestellt haben. Würdest du dich mal auf die Bank legen, Anna?«
Anna legte sich so auf die Bank, dass sie mit dem Gesicht zum Publikum gewandt war.
»Ganz schön hart«, sagte sie, »ich muss etwas unter dem Kopf haben.« Sie stand nochmals auf, holte ihren Mantel, rollte ihn zusammen und bettete ihren Kopf darauf.
Die Gruppe, welche das Stück probte, hatte sich in einem der übungsräume der Schauspielschule versammelt. Nach einer Leseprobe war das die erste szenische Stellprobe, in der Mirjam versuchte, mit den Schauspielern ihr Konzept durchzuspielen.
»Sobald du, Livia, den Wagen durch die Tür geschoben hast, beginnst du, Anna, zu sprechen und sprichst diesen irren Text, und sprich ihn wie eine Irre.«
Anna schloss die Augen und stellte sich vor, sie sei in einer psychiatrischen Klinik interniert. Träumerisch und langsam sagte sie: »Ja, jetzt! Da ist es. Ich dachte die ganze Zeit an nichts. Es ging so hin, und auf einmal richtet sich der Tag vor mir auf. Ich habe den Kranz im Haar – und die Glocken, die Glocken!« Das mit den Glocken sagte sie ganz schrill und hielt sich dabei die Ohren zu. Dann warf sie den Kopf hin und her und begann ein Glockengeläute zu imitieren, das immer lauter wurde, bis sie es plötzlich abbrach. Dann hob sie die Hände und sprach: »Sieh, ich wollte, der Rasen wüchse so über mich und die Bienen summten über mir hin.« Sie bewegte ihre Finger und imitierte das Summen von Bienen. Auch das Summen wurde immer lauter und brach dann plötzlich ab. Mit dünner, hoher Stimme sagte sie: »Sieh, jetzt bin ich eingekleidet und habe Rosmarin im Haar. Gibt es nicht ein altes Lied: –«
Dann drehte sie den Kopf zu Mirjam und den andern Schauspielern, die auf Stühlen saßen, und fragte: »Hat denn jetzt jemand dieses Lied gefunden?«
Niemand hatte es gefunden.
»Hat es überhaupt jemand gesucht?« fragte Mirjam.
Es stellte sich heraus, dass es niemand gesucht hatte.
»Ich hol’s mal auf dem Sekretariat«, sagte Jean-Pierre, ein dünner Blonder, der den Leonce spielte, »die Szene geht mich sowieso nichts an.«
»Und du meinst, dort liegen Volkslieder herum?« fragte Anna.
»Natürlich, dort liegt alles herum.«
»Aber bald wiederkommen, wir proben gleich den zweiten Akt!« rief ihm Mirjam hinterher.
»Na, da bin ich ja gespannt«, sagte Anna, »ich sing jetzt einfach irgendeine Melodie«, legte sich wieder hin und sang:
»Auf dem Kirchhof will ich liegen
Wie das Kindlein in der Wiegen …«
Dann unterbrach sie die Gouvernante und sagte teilnahmsvoll zu ihr: »Armes Kind, wie Sie bleich sind unter Ihren blitzenden Steinen.«
»Hört mal«, sagte Mirjam, stand auf und ging zu ihnen hin, »ich glaube, wir machen das ganze noch stärker auf Irrenhaus. Du spielst das ja so verrückt, Anna. Wir geben dir, Anna, ein Anstaltskostüm und dir, Livia, eine Wärterinnentracht, mit Häubchen und dem ganzen Zeug, und dann bist du streng und eisig mit der irren Prinzessin, überhaupt nicht mitfühlend.«
Livia wandte ein, sie sei aber im Stück auf der Seite der Prinzessin und verhelfe ihr zur Flucht und wie denn die Stelle »Lieber Engel, du bist doch ein wahres Opferlamm!« gehen solle, wo es in Klammer heiße »weinend«?
Sie solle das Weinen spielen, um Mitleid vorzutäuschen, schlug Mirjam vor.
Aber wie sie den Schluss der Szene machen solle? »Mein Kind, mein Kind, ich kann dich nicht so sehen«, das seien doch mitleidige Worte.
Die könne sie genauso kalt und unnahbar sprechen; auch wenn sie beim Gedanken an die Flucht sage, sie habe da so etwas im Kopf, könne sie das ohne weiteres gefährlich klingen lassen, als wolle sie die Prinzessin umbringen.
Aber sie bringe sie ja nicht um, im Gegenteil, sie sage sogar »Es kann nicht so gehen. Es tötet dich.«
Um so überraschender, wenn sie nachher zur Verbündeten der Prinzessin werde.
Aber wieso denn diese Verstellung?
Ob sie es nicht einfach mal ausprobieren könne, fragte Mirjam. Sie ärgerte sich etwas über Livias Rechthaberei, und sie glaubte zu wissen, woher sie kam. Livia hätte lieber die Prinzessin gespielt und wollte ihr jetzt das Leben schwer machen.
Читать дальше