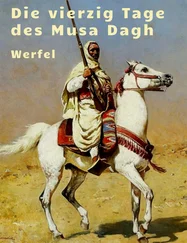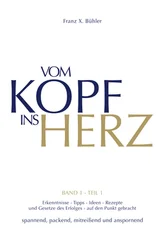»Kann ich schon«, sagte Livia schnippisch, »aber es sollte für mich auch einen Sinn machen.«
»Wenn’s nicht geht«, sagte Mirjam, »lassen wir dich als Rotkreuzschwester auftreten, als komische Nummer, mit übertriebener Zuwendung und so. Das geht dann auf alle Fälle auf. Und noch etwas. Wir machen den Auftritt so, dass die Prinzessin mit dem Gesicht zur Gouvernante auf der Bahre liegt, also vom Publikum weg.
Das gefiel nun Anna nicht. So wie sie die Szene spiele, als Irre, müsse man doch ihre Mimik sehen.
Nein, die Gestik genüge, die Gestik und die Stimme, und um so stärker sei dann der Moment, wenn sie sich zum erstenmal umdrehe.
Und wann das sein solle, fragte Anna.
Das werden sie gleich herausfinden, wenn sie die Szene einmal durchspielen, sagte Mirjam, vielleicht dort, wo es heiße »erhebt sich«, oder sie solle doch beim Spielen zu spüren versuchen, wann sie sich gern zum Publikum drehen wolle.
Livia meldete sich nochmals und sagte, das mit der komischen Nummer könne Mirjam vergessen, das mache sie nicht.
Immerhin sei es eine Komödie, wandte Mirjam ein.
Das habe sie sowieso nicht begriffen, wieso das eine Komödie sein soll, sagte Livia, und sie werde jetzt also wie gewünscht die Variante »eiskalt« durchgeben.
»Wisst ihr, was das für ein Lied ist?« rief Jean-Pierre und schwenkte einen Zettel.
Natürlich wusste es niemand.
»Es heißt ›Treue Liebe‹ und geht auf die Melodie von ›Weißt du, wie viel Sternlein stehen‹. Die zwei Zeilen sind nicht der Anfang, sondern der Schluss des Liedes.« Er sang sie vor.
»Und das lag auf dem Sekretariat rum?« fragte Mirjam.
»Es lag im Internet rum, ich hab’s schnell gegoogelt.«
»Danke«, sagte Mirjam, und sie müsse sich noch überlegen, ob das mit dem Liebeslied eine Bedeutung habe, aber Anna solle es einfach mal singen.
Anna legte sich anders hin und spielte den Anfang der Szene nochmals, etwas dramatischer als beim ersten Mal, machte das Glockengeläute nach und das Summen der Bienen und brach dann, statt das Lied zu singen, in Schluchzen aus, setzte sich auf und hielt beide Hände vor das Gesicht.
Schneidend sagte Livia: »Armes Kind, wie Sie bleich sind unter Ihren blitzenden Steinen.«
»Moment«, sagte Mirjam, »lass sie zuerst singen. Und Anna, das finde ich zu viel, und auch zu früh, um aufzustehen. Aber die Glocken und die Bienen sind sehr schön.«
Doch Anna saß auf den zwei Bänken, welche die Bahre markierten, und hörte nicht auf zu weinen.
Livia setzte sich neben sie und legte ihr den Arm um die Schulter, Mirjam kam dazu, strich ihr über die Haare und fragte sie: »Anna, was hast du denn?«
Anna schüttelte den Kopf. »Das Lied …« stammelte sie, »das Lied … die Melodie … es hat mich … umgehauen … tut mir leid.«
Alle standen nun in einem Halbkreis um sie herum, Mirjam reichte ihr ein Papiertaschentuch.
Anna wischte sich die Augen und schneuzte.
»›Weißt du, wie viel Sternlein stehen‹ – das war das einzige Lied, das mir meine Mutter gesungen hat, und ich war immer so glücklich dabei. Ich wusste nicht, dass das so tief sitzt.«
»Du kannst es singen, wie du willst, Anna, so wie vorhin, oder auch nur sprechen«, sagte Mirjam, »sollen wir eine Pause machen?«
»Gern«, sagte Anna.
Die Probe ging dann gut zu Ende, Thomas holte sie ab, sie hängte sich bei ihm ein, und sie gingen in Richtung Niederdorf, wo sie zusammen Nachtessen wollten.
»Wie ging’s, als Prinzessin?« fragte Thomas.
Anna erzählte ihm von ihrem Einbruch und sagte, sie wisse nicht, ob sie wirklich Schauspielerin werden wolle. Eine Irre zu spielen, wirklich zu spielen, sei beängstigend, sie könne das nur, indem sie sich ganz fest vorstelle, verrückt zu sein.
»Und dann musst du einen Schritt zurück machen«, sagte Thomas.
»Müsste ich, natürlich, aber wenn ich spiele, komme ich mir irgendwie vor wie … wie ein Haus, bei dem alle Türen und Fenster offen stehen.«
»Darf ich sie wieder schließen?«
»Das hast du schon fast. Aber eins musst du offen lassen.«
»Wieso?«
»Für dich.«
Thomas blieb mitten auf einem Fußgängerstreifen stehen und küsste sie.
Ein paar Tage später saß Manuel gegen 18 Uhr allein im Wartezimmer seines Kollegen, des Tinnitus-Spezialisten Anton Mannhart, und wunderte sich über die Hässlichkeit dieses Raumes. Er hatte nichts gegen die Lithographien von Fritz Hug, dem Tiermaler, aber gleich drei davon kamen ihm als überdosis vor. Die Störche, Rehe und Waldkäuze, so schön sie gezeichnet waren, wirkten seltsam unaktuell, wahrscheinlich hingen sie hier seit der Praxiseröffnung vor 25 oder 30 Jahren. Die Sessel mit dem grünen Bezug irgendeines Lederimitats waren etwas zu speckig, und das Weiß der Wände hinter den Sesseln war auf Kopfhöhe leicht abgedunkelt. Auch dass der »Nebelspalter« noch existierte, der neben dem »Tagblatt der Stadt Zürich« und der Schwerhörigenpublikation »dezibel« auf dem Wartezimmertischchen lag, erstaunte ihn, er hatte diese Zeitschrift, die sich als satirisch ausgab, nie gemocht und hatte geglaubt, sie sei schon lange eingegangen. Seit er seine Praxis an den Zürichberg verlegt hatte, lagen bei ihm Zeitschriften wie »Schöner Wohnen«, »Animan« oder »Swissboat« auf den Regalen.
Würde er, wenn er ihn nicht kennte, diesem Arzt trauen? Manuel nahm sich vor, sich morgen einmal wie ein Patient in sein eigenes Wartezimmer zu setzen. Sie unterschätzten wohl alle die Wichtigkeit dieses Eindrucks.
Auch dass jeder, der aus dem Sprechzimmer trat, am offenen Warteraum vorbeikam und sah, wer dort saß, fand Manuel unpassend, denn jetzt ging die Tür auf, und er hörte seinen Kollegen sagen: »Auf Wiedersehen, Herr Simonett.« Tatsächlich warf der Banker, der die Merkschrift »Tinnitus-Hilfe« in der Hand trug, im Abgehen einen Blick auf Manuel, grüßte ihn mit offensichtlichem Erstaunen und fragte ihn dann: »Haben Sie etwa auch eine Eisenbahn im Ohr?«
»Nicht direkt«, sagte Manuel lächelnd und ärgerte sich sogleich über diese Antwort. Deutlicher, so schien ihm, hätte er nicht ausdrücken können, dass auch er als Patient hier war.
»Grüß dich, Manuel.«
»Hallo, Toni.«
Sein Kollege Mannhart begrüßte ihn mit einem merkwürdig schwammigen Händedruck und bat ihn in sein Ordinationszimmer.
»Du hast ihn jedenfalls nicht entmutigt«, sagte Manuel, als sie drin waren, mit einer Kopfbewegung zur Türe hin, »er macht schon wieder Scherze.«
»Wir müssen den Verlauf abwarten«, sagte Mannhart, »ich geb dir gelegentlich Bescheid. Und was ist denn mit dir?«
Er war etwas älter als Manuel, knapp an der Pensionsgrenze, hatte gewelltes graues Haar und eine teilnahmsvolle Dauerfalte über der Nasenwurzel.
»Tja, was ist mit mir? Das wollte ich eigentlich dich fragen. Ich glaube, mich hat’s mit einem Tinnitus erwischt.«
Und dann schilderte er ihm seine Symptome, zeigte ihm auch sein Audiogramm, das die bewährte Frau Weibel mit ihm gemacht hatte, und sein spezialisierter Kollege stellte ihm viele der Fragen, die Manuel seinen Patienten auch stellte, seit wann, permanent oder von Zeit zu Zeit, nur nachts, auch tagsüber, in welchen Situationen, Veränderung bei anderer Haltung des Kopfes, Störungsgrad, schlafstörend, konzentrationsstörend, Hörsturz, Lärmtrauma, Lärmbelastung im Alltag usw.; er verharrte länger beim Punkt, ob die Schläge, wenn er sie höre, pulssynchron seien, so dass vielleicht eine Angiographie angezeigt wäre, doch die Schläge hatten nichts mit dem Puls zu tun, sie waren zu schnell, Manuel imitierte sie, indem er mit den Fingerknöcheln dreimal auf die Tischplatte schlug, sagte, nach der Qualität der Töne gefragt, es klinge aber eher etwas heller, so, als schlüge man gegen eine sehr dicke Fensterscheibe.
Читать дальше