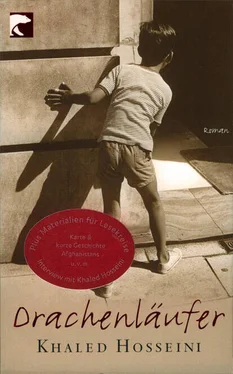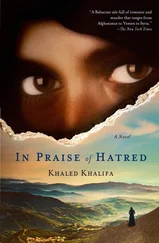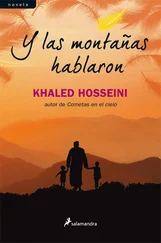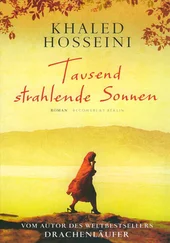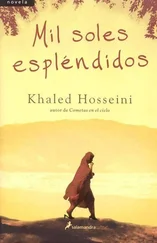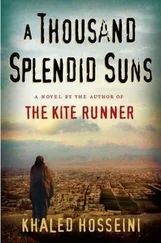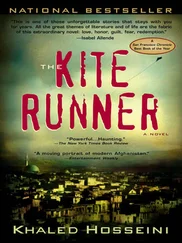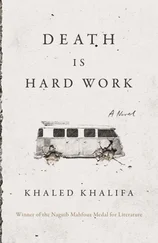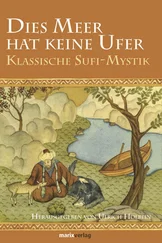Ich las sie ihm im Wohnzimmer am marmornen Kamin vor. Dieses Mal gab es kein spielerisches Abweichen vom Text; hier ging es um mich! Hassan war in vielerlei Hinsicht der perfekte Zuhörer — völlig vertieft war er, und sein Gesichtsausdruck veränderte sich mit den wechselnden Tönen der Geschichte. Als ich den letzten Satz gelesen hatte, klatschte er ganze leise Beifall.
»Mashallah, Amir Aga. Bravo!« Er strahlte.
»Es hat dir gefallen?«, fragte ich und bekam eine erneute Kostprobe — und wie süß sie war! — einer guten Kritik.
»Eines Tages, inshallah, wirst du ein großer Schriftsteller sein«, erklärte Hassan. »Und die Menschen auf der ganzen Welt werden deine Geschichten lesen.«
»Du übertreibst, Hassan«, erwiderte ich und liebte ihn doch dafür.
»Nein. Du wirst einmal groß und berühmt sein«, beharrte er. Dann entstand eine Pause, und es schien mir, als wollte er noch etwas hinzufügen. Er wog die Worte ab und räusperte sich. »Aber würdest du mir erlauben, dir eine Frage zu der Geschichte zu stellen?«, sagte er schüchtern.
»Aber gewiss.«
»Nun…«, begann er und verstummte.
»Nur heraus damit, Hassan«, ermunterte ich ihn. Ich lächelte, obwohl der unsichere Schriftsteller in mir gar nicht so genau wusste, ob er es überhaupt hören wollte.
»Nun«, sagte er wieder, »ich würde gern eins wissen: Warum hat der Mann seine Frau umgebracht? Warum hat er überhaupt jemals traurig sein müssen, um Tränen zu vergießen? Warum hat er nicht einfach an einer Zwiebel gerochen?«
Ich war fassungslos. Diese Möglichkeit, die so offensichtlich war, dass sie mir zugleich schon wieder ausgesprochen albern erschien, war mir nicht einmal in den Sinn gekommen. Ich bewegte die Lippen und brachte doch keinen Laut hervor. Wie es schien, sollte ich an demselben Abend, an dem ich von einem der Ziele der Schriftstellerei, der Ironie, erfahren hatte, auch Bekanntschaft mit einem ihrer Fallstricke machen: der Lücke in der Handlung. Und das wurde mir ausgerechnet von Hassan beigebracht. Hassan, der nicht lesen konnte und in seinem ganzen Leben nicht ein einziges Wort geschrieben hatte. Plötzlich begann eine kalte, finstere Stimme in meinem Ohr zu flüstern: Was weiß der denn schon, der ungebildete Hazara? Er wird niemals mehr als ein Diener sein. Wie kann er es wagen, mich zu kritisieren?
»Nun«, begann ich. Doch ich kam nicht dazu, diesen Satz zu beenden.
Denn plötzlich veränderte sich das Afghanistan, das wir kannten, für immer.
Irgendetwas grollte wie Donner. Die Erde bebte leicht, und wir vernahmen das Rattern von Maschinengewehren. »Vater!«, schrie Hassan. Wir sprangen auf die Füße und rannten aus dem Wohnzimmer. Ali kam hektisch durch die Halle auf uns zugehumpelt.
»Vater! Was ist das für ein Geräusch?«, rief Hassan und streckte Ali die Hände entgegen. Ali legte die Arme um uns. Ein weißes Licht blitzte auf, tauchte den Himmel in Silber. Ein weiteres Blitzen, gefolgt von einem raschen Stakkato von Schüssen.
»Sie jagen Enten«, erklärte Ali mit heiserer Stimme. »Sie jagen Enten bei Nacht, wisst ihr. Habt keine Angst.«
In der Ferne ertönte eine Sirene. Irgendwo zersplitterte Glas, und jemand rief etwas. Ich hörte Menschen auf der Straße, die aus dem Schlaf gerissen worden waren und, wahrscheinlich noch in ihren Pyjamas, das Haar zerzaust, die Augen verquollen, dort herumliefen. Hassan weinte. Ali zog ihn an sich, umklammerte ihn voller Zärtlichkeit. Später sollte ich versuchen mir einzureden, dass ich Hassan in dem Moment nicht beneidet hatte. In keiner Weise.
So kauerten wir bis in die frühen Morgenstunden beieinander. Die Schießereien und die Explosionen dauerten weniger als eine Stunde, aber sie jagten uns große Angst ein, denn keiner von uns hatte jemals Gewehrschüsse auf den Straßen vernommen. Das waren damals noch ungewohnte Geräusche. Die Generation afghanischer Kinder, deren Ohren nichts als die Geräusche von Bomben und Geschützfeuer kennen würden, war noch nicht geboren. Zusammengekauert saßen wir da und warteten, dass die Sonne aufgehen würde; keiner von uns ahnte damals, dass es mit unserem bisherigen Leben für immer vorbei sein sollte. Wenn auch noch nicht sofort, so war es zumindest der Anfang vom Ende. Das Ende, das offizielle Ende, sollte zunächst im April 1978 mit dem kommunistischen Umsturz kommen und vor allem dann im Dezember 1979, als russische Panzer durch die Straßen rollten, auf denen Hassan und ich spielten. Sie brachten den Tod des Afghanistans, das ich kannte, und leiteten eine bis heute nicht beendete Epoche des Blutvergießens ein.
Kurz vor Sonnenaufgang kam Babas Wagen die Auffahrt heraufgerast. Die Tür wurde zugeknallt, und dann stapften seine eiligen Schritte die Stufen hinauf. Als er im Türrahmen auftauchte, erblickte ich etwas in seinem Gesicht, was ich nicht sofort erkannte, weil ich es dort noch nie gesehen hatte: Angst. »Amir! Hassan!«, rief er, als er mit ausgebreiteten Armen auf uns zugelaufen kam. »Sie haben sämtliche Straßen blockiert, und das Telefon ging nicht. Ich habe mir solche Sorgen gemacht!«
Wir ließen uns von ihm in die Arme schließen, und für einen kurzen, wahnsinnigen Moment war ich froh über das, was in jener Nacht geschehen war — was auch immer es gewesen sein mochte.
Sie hatten doch keine Enten geschossen. Wie sich herausstellte, hatten sie in jener Nacht des 17. Juli 1973 überhaupt nicht viel geschossen. Als Kabul am nächsten Morgen erwachte, gehörte die Monarchie der Vergangenheit an. Der König, Zahir Shah, hielt sich gerade in Italien auf. Da hatte sein Cousin, Daoud Khan, die vierzigjährige Herrschaft des Königs mit einem unblutigen Staatsstreich beendet.
Ich erinnere mich noch daran, wie Hassan und ich an jenem Morgen draußen vor dem Arbeitszimmer meines Vaters kauerten, während Baba und Rahim Khan schwarzen Tee tranken und auf Radio Kabul den neuesten Nachrichten über den Staatsstreich lauschten.
»Amir Aga?«, flüsterte Hassan.
»Ja?«
»Was ist eine Republik?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Weiß ich nicht.« In Babas Radio sagten sie das Wort immer wieder.
»Amir Aga?«
»Ja?«
»Bedeutet Republik, dass Vater und ich von hier weggehen müssen?«
»Das glaube ich nicht«, flüsterte ich zurück.
Hassan dachte darüber nach. »Amir Aga?«
»Ja?«
»Ich will nicht, dass sie Vater und mich wegschicken.«
Ich lächelte. »Bas, du Esel. Niemand schickt dich fort.«
»Amir Aga?«
»Ja?«
»Hast du Lust, auf unseren Baum zu klettern?«
Ich musste lächeln. Das war wieder einmal typisch für Hassan. Er fand doch immer das rechte Wort zur rechten Zeit — und die Nachrichten im Radio wurden allmählich auch langweilig. Hassan ging in seine Hütte, um sich etwas überzuziehen, und ich rannte nach oben, um ein Buch zu holen. Dann lief ich in die Küche, stopfte mir die Taschen mit Pinienkernen voll und rannte nach drau ßen, wo Hassan auf mich wartete. Wir stürmten durch das Eingangstor und machten uns auf den Weg zum Hügel.
Wir überquerten die Wohnstraße und gingen geradeüber ein Stück Ödland, das zum Hügel hinaufführte, als Hassan plötzlich ein Stein im Rücken traf. Wir wirbelten herum, und mir rutschte das Herz in die Hose. Assef und zwei seiner Freunde, Wali und Kamal, kamen auf uns zu.
Assef war der Sohn eines Freundes meines Vaters namens Mahmood, eines Piloten, der bei einer Fluggesellschaft angestellt war. Seine Familie wohnte ein paar Straßen südlich von unserem Haus in einer vornehmen Siedlung mit hohen Mauern und Palmen. Wenn man als Kind im Wazir-Akbar-Khan-Viertel von Kabul lebte, wusste man Bescheid über Assef und seinen berühmten rostfreien Schlagring — hoffentlich ohne schon einmal persönlich dessen Bekanntschaft gemacht zu haben. Als Sohn einer deutschen Mutter und eines afghanischen Vaters überragte der blonde, blauäugige Assef alle anderen Kinder. Der wohlverdiente Ruf seiner Grausamkeit eilte ihm auf den Straßen voraus. Flankiert von seinen gehorsamen Freunden, schritt er durch das Viertel wie ein Khan, der mit seinem Gefolge, das darauf bedacht ist, ihm jeden Wunsch zu erfüllen, durchs Land zieht. Sein Wort war Gesetz, und wenn man Nachhilfe in Rechtsfragen benötigte, dann war dieser Schlagring genau das richtige Werkzeug. Ich habe einmal gesehen, wie er diesen Schlagring bei einem Kind aus dem Karteh-Char-Viertel eingesetzt hat. Ich werde nie vergessen, wie Assefs blaue Augen dabei funkelten — als wäre er von Sinnen — und wie er grinste, grinste, während er auf das arme Kind einschlug, bis es das Bewusstsein verlor. Einige Jungen im Wazir-Akbar-Khan-Viertel hatten ihm den Spitznamen Assef Goshkhor, Assef der Ohrenfresser, gegeben. Natürlich traute sich keiner, ihm den Namen ins Gesicht zu sagen, um nicht das gleiche Schicksal erleiden zu müssen wie der arme Junge, der, ohne es zu wollen, zum Urheber dieses Spitznamens wurde, als er sich wegen eines Drachens mit Assef prügelte und am Ende sein rechtes Ohr aus der dreckigen Gosse fischen musste. Jahre später lernte ich in Amerika ein Wort für eine Kreatur wie Assef, ein Wort, für das es kein gutes Äquivalent im Farsi gibt: Soziopath.
Читать дальше