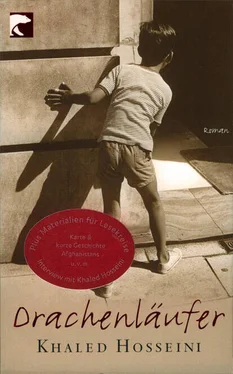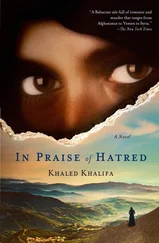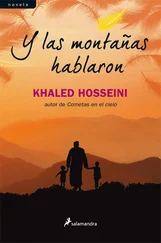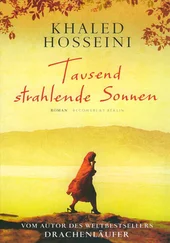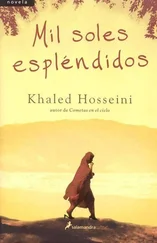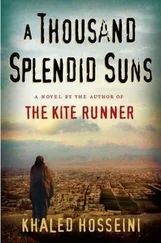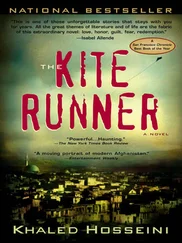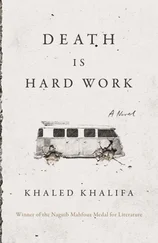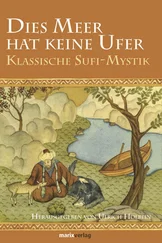»Ich will aber nicht vergessen«, entgegnete ich. »Gib mir zehn Minuten.«
Es hatte uns, Hassan und mich, kaum einen Schweißtropfen gekostet, den Hügel unmittelbar nördlich von Babas Haus zu erklimmen. Wir jagten uns gegenseitig das letzte Stück nach oben, tollten herum oder setzten uns auf einen Felsvorsprung, der uns einen weiten Ausblick auf den Flughafen in der Ferne bot. Wir sahen Flugzeuge starten und landen. Und dann rannten wir wieder los.
Als ich jetzt endlich die zerklüftete Hügelkuppe erreichte, meinte ich mit jedem keuchenden Luftholen Feuer zu schlucken. Mein Gesicht war schweißnass. Ich hatte Seitenstechen und musste immer wieder stehen bleiben. Immerhin brauchte ich nicht lange, um den verlassenen Friedhof zu finden. Den alten Granatapfelbaum gab es immer noch.
Ich lehnte mich an den aus grauem Stein gemauerten Pfosten am Eingang zum Friedhof, auf dem Hassan seine Mutter begraben hatte. Das alte Tor, das schon damals nicht mehr in den Angeln gehangen hatte, war weg, und das Unkraut stand überall so hoch, dass die Grabsteine fast darin verschwanden. Auf der niedrigen Mauer, die das Feld umschloss, hockten zwei Krähen.
In seinem Brief hatte Hassan erwähnt, dass der Granatapfelbaum schon seit Jahren keine Früchte mehr trug. Angesichts der trockenen, entblätterten Zweige bezweifelte ich, dass dies je wieder der Fall sein würde. Ich dachte daran, wie oft wir auf diesen Baum geklettert waren, mit baumelnden Beinen rittlings auf seinen Ästen gehockt hatten, bestrahlt vom flackernden Sonnenlicht, das durch das Laub fiel. Mir war, als schmeckte ich das strenge Aroma von Granatäpfeln auf der Zunge. Ich ließ mich auf die Knie fallen und fuhr tastend mit den Händen über den Stamm. In der verwitterten Rinde war das, wonach ich suchte, nur noch vage auszumachen: »Amir und Hassan, die Sultane von Kabul.« Mit den Fingern folgte ich der Kontur jedes einzelnen Buchstabens und zupfte an den Rändern der kleinen Einschnitte.
Mit verschränkten Beinen saß ich am Fuß des Baums und blickte in südlicher Richtung über die Stadt meiner Kindheit. Damals ragten hinter den Mauern eines jeden Hauses Bäume auf. Der Himmel war weit und blau, und in der Sonne trocknete schimmernde Wäsche an den Leinen. Wenn man die Ohren spitzte, konnte man sogar die Rufe des Obsthändlers hören, der seinen Esel durch das Wazir-Akbar-Khan-Viertel trieb: Kirschen! Aprikosen! Weintrauben! Am frühen Abend konnte man das azan hören, die Aufforderung des Muezzin der Moschee in Shar-e-Nau zum Gebet.
Farid hupte. Ich sah ihn mit der Hand winken. Es war Zeit zu gehen.
Wir fuhren zurück zum Paschtunistan-Platz und begegneten wieder mehreren roten Pick-ups voller bärtiger junger Männer. Farid fluchte jedes Mal leise vor sich hin.
Ich zahlte für ein Zimmer in einem kleinen Hotel nahe dem Paschtunistan-Platz. Drei kleine Mädchen, zum Verwechseln ähnlich in ihren schwarzen Kleidern und weißen Schals, hingen an dem schmächtigen bebrillten Mann hinter dem Empfangsschalter. Er verlangte 75 Dollar, einen für dieses offensichtlich heruntergekommene Haus geradezu astronomischen Preis. Ich beschwerte mich nicht. Es macht schließlich einen Unterschied, ob man mit Beutelschneiderei ein Strandhaus auf Hawaii zu finanzieren oder die eigenen Kinder durchzufüttern versucht.
Es gab kein heißes Wasser, und die kaputte Kloschüssel war ohne Spülung. Das schmale Bett bestand aus einem Metallgestell, einer durchgelegenen Matratze und einer zerlumpten Decke. In der Ecke stand ein Holzstuhl. Die Scheibe des auf den Platz hinausgehenden Fensters war zerbrochen, nicht ersetzt worden. Als ich den Koffer absetzte, entdeckte ich an der Wand hinter dem Bett einen getrockneten Blutfleck.
Ich gab Farid Geld und schickte ihn los, etwas zum Essen zu holen. Er kehrte mit vier dampfenden Fleischspießen zurück, frischem naan und einer Schale weißem Reis. Wir setzten uns auf das Bett und langten mit großem Appetit zu. Eines hatte sich in Kabul dann doch nicht verändert: Der Kebab war so saftig und köstlich wie immer.
Ich schlief im Bett, Farid auf dem Boden, in eine Decke gewickelt, die mir der Hotelier zusätzlich in Rechnung stellte. Abgesehen vom Mond, der durch das zerbrochene Fenster leuchtete, gab es kein Licht. Farid hatte von unserem Wirt erfahren, dass Kabul seit zwei Tagen ohne Strom sei und der hauseigene Generator repariert werden müsse. Wir unterhielten uns noch eine Weile. Er erzählte von seiner Jugend in Mazar-e-Sharif und Jalalabad und berichtete von seiner und seines Vaters Teilnahme am Djihad und wie sie im Panjshir-Tal gegen die shorawi angetreten waren. Sie hatten ohne Lebensmittel festgesessen und sich von Heuschrecken ernähren müs sen. Er berichtete von dem Tag, an dem sein Vater von einem Hubschrauber aus beschossen und getötet wurde, von dem Tag, da seine zwei Töchter einer Landmine zum Opfer gefallen waren. Und er erkundigte sich nach Amerika. Ich erzählte ihm dann, dass man in den Läden dort zwischen fünfzehn bis zwanzig verschiedenen Müsli-Sorten auswählen könne, dass das Lammfleisch immer frisch, die Milch kalt, das Obst reichlich und das Wasser sauber und klar sei. Dass jeder Haushalt einen Fernseher und jeder Fernseher eine Fernbedienung habe und dass jeder, der es wünsche, eine Satellitenschüssel aufs Dach montieren könne, mit der sich über fünfhundert verschiedene Programme empfangen ließen.
»Fünfhundert?«, rief Farid.
»Fünfhundert.«
Für eine Weile sagte keiner von uns ein Wort. Ich war wohl gerade eingeschlafen, als Farid auf einmal zu kichern anfing. »Amir, hast du davon gehört, was Hodscha Nasreddin getan hat, als seine Tochter eines Tages nach Hause kam und sich darüber beschwerte, von ihrem Mann geschlagen worden zu sein?«, fragte er, und ihm war anzuhören, dass er grinste. Auch ich schmunzelte unwillkürlich. Es gab wohl auf der ganzen Welt keinen Afghanen, der nicht schon einmal Witze über diesen zerstreuten Hodscha gehört hatte.
»Was?«
»Er hat sie ebenfalls geschlagen und dann zurückgeschickt mit dem Auftrag, ihrem Mann zu sagen, dass mit ihm, dem Mullah, nicht zu spaßen sei: Wenn der Hurensohn seine Tochter schlüge, dann würde er, der Hodscha, seine Frau dafür schlagen.«
Ich lachte. Teils über den Witz, teils darüber, dass sich afghanischer Humor offenbar nie änderte. Es wurden Kriege geführt, das Internet war erfunden, ein Roboter war über die Oberfläche des Mars gerollt, und in Afghanistan erzählte man sich immer noch Witze über Hodscha Nasreddin. »Kennst du den, wie der Hodscha, einen schweren Sack auf den Schultern, auf seinem Esel reitet?«, sagte ich.
»Nein.«
»Er wird auf der Straße von jemandem gefragt, warum er den Sack denn nicht dem Esel aufladen würde? Worauf er antwortet, dass das arme Tier mit ihm doch schon genug zu schleppen habe.«
Wir tauschten noch ein paar weitere HodschaNasreddin-Witze aus, bis uns keine mehr einfielen, dann wurde es wieder still.
»Amin« Farid schreckte mich aus dem Halbschlaf auf.
»Ja?«
»Warum bist du hier? Was ist der eigentliche Grund?«
»Das habe ich doch gesagt.«
»Wegen dem Jungen?«
»Wegen dem Jungen.«
Farid wälzte sich auf dem Boden herum. »Kaum zu glauben.«
»Ich kann’s manchmal selbst nicht glauben, dass ich hier bin.«
»Nein… ich meine, warum ausgerechnet dieser Junge? Du bist den ganzen weiten Weg von Amerika gekommen… für einen Shi’a?«
Mit meiner guten Laune war es vorbei. Auch mit meiner Nachtruhe. »Ich bin müde«, sagte ich. »Lass uns schlafen.«
»Inshalla, ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt«, murmelte Farid.
»Gute Nacht«, sagte ich und drehte mich zur Seite. Bald hallte Farids Schnarchen durch den kahlen Raum. Ich hatte die Hände auf der Brust gefaltet, starrte durch das eingeschlagene Fenster auf den Sternenhimmel und dachte, dass womöglich wahr sein mochte, was andere über Afghanistan sagten. Vielleicht war es tatsächlich ein Land, für das es keine Hoffnung gab.
Читать дальше