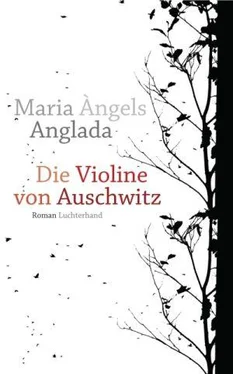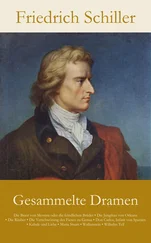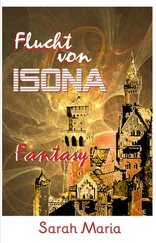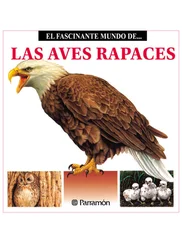Hunger plagte ihn. Er war jung und wollte leben. Das Mittagessen würde den Hunger bloß täuschen.Vielleicht würde ihm die Köchin heimlich ein paar Reste zustecken, manchmal wagte sie es, wenn Er sich nach dem Essen zum Lesen zurückzog. Fünf Stunden Arbeit mit nichts als einem wässrigen Kaffee-Ersatz und einem Stück Brot im Magen ließen ihn beinahe zusammenbrechen.
Als sie gerade aus der Diele hinausgehen wollten, rollten plötzlich, von lautem Gelächter begleitet, drei goldene Äpfel zu Boden – eine Sinnestäuschung? Seine Kameraden und er krochen auf allen vieren, um sie zu erhaschen, während sich der Kommandant damit vergnügte, sie mit den Füßen wegzuschießen. Daniel fühlte sich keineswegs in seinem Stolz verletzt, als er sich bückte, um einen Apfel zu erwischen. Die Schande lag bei demjenigen, der sich über seinen Hunger lustig machte. Ein riesiger schwarzer Stiefel bedrohte seine Hand, zog sich aber schließlich zurück, um die Frucht noch weiter wegzustoßen, doch es gelang Daniel, sie an sich zu reißen. Man nahm ihn nicht fest, man hetzte auch nicht die Hunde auf ihn, als er in den Apfel hineinbiss, denn Er war eindeutig in guter Laune aufgestanden. Der Grund dafür wurde klar, als eine Frauenstimme von oben nach ihm rief. Offensichtlich hatte die schöne Prostituierte seinen Wünschen entsprochen, und man würde ihn und die anderen nun vielleicht zwei oder drei Tage schonen.Vielleicht.
Der Nachmittag zog sich in die Länge, trotz der Erinnerung an den Apfel.
Nach den Tagen, die er im Arrest verbracht hatte, kam ihm selbst seine Pritsche in der Baracke weich vor. Und er empfand die Anwesenheit der Kameraden, die mehr oder weniger genauso verlaust und schmutzig waren wie er, als vertraut und tröstlich.
Diesmal weckte man ihn. Er durfte nicht noch einmal verschlafen! Denn sonst hätte ihn niemand mehr vor der gefürchteten Züchtigung schützen können, und der Blick des Arztes Rascher hatte nichts Gutes verheißen. Obwohl ihn die Schläge noch schmerzten, hatte er die Nacht durchschlafen können und war, vielleicht weil er nicht allein war, auch von keinen Alpträumen geplagt worden. Der Schreiber ihrer Baracke hatte ihn, als er ihn weckte, aus einer anderen Welt zurückgeholt. Im Traum war er in seiner säuberlich geordneten Werkstatt gewesen und hatte inmitten der ihm wohl bekannten und geliebten Gerüche der Hölzer, Leime und Lacke an einer Bratsche gearbeitet – was für ein Unterschied zu dem Mief in der Baracke. Im oberen Stockwerk hatte seine Mutter beim Vorbereiten des Mittagessens vor sich hingeträllert, das ebenfalls einen köstlichen Duft verströmte. Lauter beglückende Sinneseindrücke waren ihm vergönnt gewesen: Die Sonne vergoldete die Hölzer und entlockte ihnen ein Schimmern wie das der Abenddämmerung; warme rötliche Farben wie altes Gold, seltsamerweise auch Blautöne, und kontrastierend glänzte der kalte Stahl seiner Werkzeugsammlung. Die noch unbearbeiteten, für künftige Instrumente zugeschnittenen Stücke ließen ihre Maserungen aufleuchten, sie dufteten, und zwischen ihnen strich Luft hindurch, die sie mit der Zeit langsam trocknen ließ. Er hatte schon von seinem Vater gelernt, nie ein Holz zu verwenden, das nicht mindestens fünf Jahre vorher geschlagen worden war. Das Holz einer kräftigen Bergfichte oder eines Spitzahorns, von Bäumen, in denen Vögel genistet hatten. In denen der Wind gesungen hatte, wie es später der Bogen tun sollte. Im Traum hatte jedes Teil und jedes Werkzeug wie ein Schmuckstück geglänzt, und sie waren tatsächlich die bescheidenen Kleinode seiner Handwerkskunst. Im Traum war er an einem der heikelsten Schritte seiner Tätigkeit angelangt: Es galt, der Bratsche die Seele einzusetzen, jenes kleine Fichtenholzstückchen mit feiner, dichter Maserung, das er nun senkrecht, ganz gerade und genau unter dem rechten Füßchen des Stegs anbringen wollte. Doch was geschah? Ihm schwitzten die Hände, der Stimmstock blieb nicht an der richtigen Stelle, entglitt ihm zu früh! Die Seele war ihm zu kurz geraten, war unbrauchbar. Er musste von Neuem beginnen. Doch da sank die Bratsche tiefer und tiefer …
In diesem Augenblick des Traums war er wach gerüttelt worden. Die Bratsche war ohne Seele geblieben. Das schien ihm ein schlechtes Omen zu sein.
Man brauchte aber nicht im Traum oder in der Ferne ein schlechtes Vorzeichen zu suchen. Er hatte es vor sich, direkt vor Augen. Das schlechte Omen war ganz einfach die Morgendämmerung. Das Anbrechen eines neuen Tages in der Gehenna, im Dreiflüsselager .
Ein düsterer Morgen, Vorbote eines grauen, diesigen Tages, eine alte Bettdecke auf der trostlosen, schäbigen Lagerstatt. Kein Alptraum, dachte er, konnte schlimmer sein als die Grausamkeit, die sie umgab und durchdrang, so unvermeidlich wie die Luft, die sie atmeten. Sie waren ihr ausgeliefert, schutzlos wie Säuglinge. Es schien ihm, als seien sie von allen – auch von Jahwe – verlassen worden, als seien sie den Händen eines Hasses preisgegeben, der für ihn unbegreiflich war. Er hatte seinen Vater von früheren Vertreibungen und Pogromen sprechen hören, zu Zeiten der Großväter; seine Kindheit jedoch war in Geborgenheit verlaufen, und sie hatten seine Bar-Mizwa ebenso wie die seines Bruders mit einem fröhlichen Fest begangen. Erst als sein Vater krank wurde und schließlich starb, war jener Frieden zerstört worden. Vielleicht hatte der Sturm sie deshalb auf so unerwartete Weise überrascht; Daniel hatte, vertieft in seine geliebte Arbeit, die bedrohlichen Zeichen, die immer schwärzer werdenden Wolken nicht wahrgenommen, so als würden sie die Seinen nicht betreffen. Er hatte sich zu Beginn der Tyrannei den gelben Davidstern angeheftet, ohne auf den Gedanken zu kommen, damit das Brandmal des Todes zu tragen, gezeichnet zu sein wie die Bäume für den Axthieb, und er war nicht wirklich in die neue und brutale Realität erwacht – bis zu jenem Schreckenstag, an dem sie seine Werkstatt plünderten. Ganz in der Nähe stand die alte Synagoge in Flammen, stets hatte er sich dort in den Falten des langen Tallits seines Vaters geborgen gefühlt, an dessen Seite er oft an den Feiertagen hingegangen war. Seit damals, dachte er nun, bedeutete jeder Tag einen Schritt, der sie mehr und mehr in den schlammigen Wassern versinken ließ, die sie schließlich alle verschlingen würden.
Der zweite Arbeitstag nach seiner Rückkehr aus der Zelle erschien ihm länger als der erste, aber er wusste nicht recht, warum. Er fühlte, wie sich in seinem Herzen Mutlosigkeit ausbreitete, ein Fatalismus, der in Verzweiflung münden würde. Er kannte diese Anzeichen: Oft genug hatte er mitangesehen, wie Lagerkameraden krank wurden und sich dem Tod auslieferten; nun lagen sie auf einem der umliegenden Hügel begraben. Er war allerdings noch jung, und so versuchte er sich Mut zu machen, eine Zeit lang würde er kämpfen. Todmüde kam er in der Baracke an, er hatte keine Lust zu reden, dachte nur daran, sich hinzulegen. Nach ihm kehrten erschöpft die Kameraden zurück, die draußen und im Steinbruch geschuftet hatten.
An diesem Abend gab es aber eine Überraschung, einen zarten Hoffnungsschimmer. Neue Zwangsarbeiter waren angekommen, um die Abgänge zu ersetzen. Einer der Neuankömmlinge, dem sie die Pritsche neben ihm zuwiesen, war ein Mechaniker aus seiner Straße, ein guter Bekannter. Daniel erblickte in seinen Augen das Erstaunen und den Schmerz, ihn so mager, so abgezehrt zu sehen. Sie umarmten sich unter Tränen; körperliche Schwäche lässt die Tränen leichter fließen. Bald jedoch empfand der Geigenbauer zum ersten Mal im Dreiflüsselager ein Gefühl der Freude. Eva war am Leben, berichtete sein Nachbar, und es ging ihr den Umständen entsprechend gut. Er hatte sie gesehen, als er in der Fabrik für Militäruniformen, die Tisch leitete, etwas repariert hatte – in dem Paradies, von dem im Lager hinter vorgehaltener Hand gesprochen wurde. Ja, Eva aß jeden Tag kräftige Scheiben Brot, die der Industrielle in seiner ungewöhnlichen Güte aus eigener Tasche für die Arbeiter kaufen ließ. Oft glänzte auf dem Brot sogar ein Hauch Margarine … oder Butter!
Читать дальше