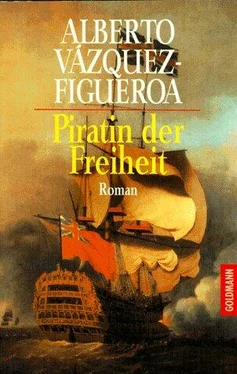»Jeden in meiner Lage kann man bekehren«, erwiderte Hauptmann Sancho Mendana. »Aber wie soll man verstehen, daß ein Mädchen, das eine prachtvolle Zukunft vor sich haben und sich mit ihrem Geld einen Palast am schönsten Ort der Welt kaufen könnte, auf all das verzichtet? Was hat dich zu einem solchen Entschluß getrieben?«
Celeste Heredia dachte lange über ihre Antwort nach, betrachtete das dunkle Meer, auf dem sich schwach die Positionslichter der zwei Seemeilen backbord segelnden Maria Bernarda spiegelten, und fragte schließlich:
»Erinnerst du dich an meinen Lehrer, Bruder Anselmo de Avila?«
»Natürlich! Ein faszinierender Mensch. Und sehr intelligent.«
»Ein Weiser, ja fast ein Heiliger! Ich war ein trauriges kleines Mädchen, rebellisch und verbittert, das immer wieder an Selbstmord dachte. Das Leben erschien mir so grausam und ungerecht, und deshalb wollte ich es beenden. Aber Bruder Anselmo hat in kurzer Zeit einen anderen Menschen aus mir gemacht. Er hat einen großen Teil seines Lebens auf Kuba verbracht und mir erklärt, wie ungerecht und grausam es auf den Zuckerplantagen zuging. Dort hatte er versucht, den Sklaven zu helfen, bis die Eigentümer beim Gouverneur intervenierten und dieser ihn wegen rebellischer Umtriebe< deportieren ließ.«
»Ich erinnere mich daran«, räumte der Offizier ein. »Als er nach Margarita kam, haben sie uns vor seinen revolutionären Ideen gewarnt. Allerdings hat er nie Probleme gemacht.«
»Weil es auf Margarita nicht viele Sklaven gibt. Außerdem haben wir sie nie so behandelt wie auf Kuba oder Puerto Rico. Für uns sind sie nur Schwarze, die etwas ärmer sind als die Weißen, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um für einen Hungerlohn nach Perlen zu fischen.«
»Und die Schwarzen zwingen, in zu große Tiefen zu tauchen, wodurch viele von ihnen ertrinken«, bemerkte der Artillerist.
»Das stimmt wohl. Aber Bruder Anselmo versicherte, daß die Schwarzen auf Margarita sich gut behandelt fühlen würden, weil sie ihre Arbeit mit den Weißen teilen und in relativer Freiheit leben. Auf Kuba gehen sie mit den Schwarzen dagegen wie mit Vieh um, zwingen sie, achtzehn Stunden täglich zu arbeiten und in Ketten zu schlafen.«
»Achtzehn Stunden täglich!« entsetzte sich der andere. »Das ist doch nicht möglich!«
»Und ob!« bestätigte Celeste, die immer mehr in Zorn geriet. »Irgendwann sind sie völlig erschöpft, und wenn ihnen ihre Herren dann etwas Ruhe gönnen, weil sie ansonsten keinen Profit mehr einbringen, ist es zu spät. Also läßt man sie einfach am Wegrand zurück, damit sie Hungers sterben.«
»Ich kann nicht glauben, daß die Krone so etwas zuläßt. Die Gesetze sehen vor…«
»Wir wissen alle, daß die Gesetze aus Sevilla in der Neuen Welt nur Schall und Rauch sind. Die Krone führt zugunsten des Sklavenhandels vor allem ins Feld, daß wir einige arme Eingeborene befreien, die unter dem Joch einiger Häuptlinge leben, von denen sie in Sünde und Unwissenheit gehalten werden. Wir dagegen retten ihre Seelen mit einem neuen Leben, in dem wir ihnen den Weg zum wahren Glauben weisen, nicht wahr?«
»So heißt es auf jeden Fall.«
»Wenn das so ist… warum retten wir dann nur Männer, die in einem Alter sind, in dem sie den größten Profit auf einer Zuckerplantage abwerfen? Von zehn Schwarzen, die auf Kuba an Land gehen, sind neun junge Männer, zwischen fünfzehn und zwanzig Jahre alt, die nicht nur schuften und hungern müssen und der Verzweiflung nahe sind, sondern auch noch auf Frauen verzichten müssen. Die Krone und die Kirche, die das billigt, macht aus jungen und arglosen Männern, die in ihrer Heimat nach klaren und naturgemäßen Bräuchen leben, schmutzige Sodomiten, die kein Recht auf Kinder haben: Das ist nicht einmal dem niedrigsten aller Tiere verwehrt.«
»Niemals hätte ich gedacht, daß sie keine Frauen haben«, gestand der Offizier.
»Aber so ist es«, beharrte sie. »Die Plantagenbesitzer haben herausgefunden, daß es viel kostspieliger ist, ein Negerkind aufzuziehen, bis es arbeiten kann, als schon erwachsene junge Männer aus Afrika einzuführen. Daher sind sie auch nicht daran interessiert, daß die Sklavinnen schwanger werden, wenn sie sie nicht selbst schwängern. Die logische Folge sind Homosexualität, Masturbation und Sodomie unter den jungen Sklaven.«
Hauptmann Sancho Mendana war beim aufmerksamen Zuhören die Pfeife ausgegangen. Lange dachte er nach und schüttelte schließlich ungläubig den Kopf.
»Wenn ich dich so ansehe, kann ich kaum glauben, daß du jenes kleine Mädchen bist, das am Hosenbein seines Bruders hing und ihm überallhin folgte. Aber noch weniger kann ich fassen, daß ein Dominikanermönch mit einer wohlerzogenen Senorita solche Gespräche führt.«
»Bruder Anselmo hat die Menschen nie nach ihrer gesellschaftlichen Stellung, ihrem Geschlecht oder ihrem Alter beurteilt, sondern immer nach ihrem Verstand, und keiner konnte diesen Verstand besser schärfen als er. Er hat mich als unglückliches kleines Mädchen kennengelernt, das nur darüber nachgrübelte, wie es sich für das Übel rächen konnte, das man ihm angetan hatte. Er konnte mich davon überzeugen, daß ich angesichts dessen, was die meisten Menschen zu leiden hatten, ein privilegiertes Geschöpf war.«
»Aber dir von Homosexualität und Masturbation zu erzählen, das erscheint mir doch etwas übertrieben…«
»Bestimmt gibt es Tausende frommer Damen, vor denen man diese Worte nicht einmal aussprechen könnte. Aber denen käme es auch nicht in den Sinn, daß es unmoralisch und ungerecht sein könnte, hundert junge Männer das ganze Leben lang in einer winzigen und stinkenden Sklavenhütte aneinanderzuketten. Bruder Anselmo versicherte mir, daß diese scheinheiligen Hexen es als Sünde ansähen, diesen Männern eine Frau zu geben; aber sie Tag für Tag und Jahr für Jahr in dieses üble Laster zu treiben, das hieß, unserer Verpflichtung, sie zu >christianisieren<, nachzukommen.«
»Ein seltsamer Mönch, bei Gott!«
»Er war schon in Ordnung. Und wenn ein trauriges und einsames Mädchen einem solchen Mann begegnet, der ihr die Augen öffnet, ihr eine so andere Welt zeigt und mit ihr wie mit einer Erwachsenen spricht, dann reagiert man entweder so wie ich oder man ist aus Stein.« Sie schenkte ihm ein bezauberndes Lächeln. »Beantwortet das deine Frage?«
»Natürlich!« sagte der Margariteno und stand auf, um zu seiner Hängematte zurückzukehren, die er unter freiem Himmel auf dem Achterkastell aufgespannt hatte. »Auch wenn sie mir jetzt ziemlich albern vorkommt.«
Vier Tage folgten sie nun schon mißmutig dem Kielwasser der stinkenden Maria Bernarda. Deren schlaffe Segel konnten den Wind nicht einfangen, und so trieb lediglich eine sanfte Meeresströmung sie nach Westen. Endlich kündigten die ersten Möwen und Tölpel die nahe Küste an. Doch als alle Augen den Horizont nach Land und damit dem Ende der zeitraubenden Fahrt absuchten, rief plötzlich Silvino Peixe vom Mastkorb herab:
»Schiff in Sicht! Backbord!«
Während die Maria Bernarda ihren Kurs um kein Jota änderte, steuerte die Dama de Plata auf die im Dunst verschwimmende Silhouette eines düsteren Schiffs zu.
Doch ein Schiff konnte man das eigentlich nicht mehr nennen, was da träge auf dem ruhigen Wasser schaukelte, eher schon den halbverwesten Kadaver von etwas, was lange zuvor einmal ein Sklavenschiff gewesen war: ein wuchtiger, mächtiger Kahn mit fast tausend Tonnen Wasserverdrängung. Jetzt bot er nur noch einen kläglichen Anblick: Die Segel waren zerschlissen, die Masten zersplittert, und die Taue baumelten wie die schlaffen Tentakel eines Riesenkraken an der Bordwand herab. Allein beim Anblick von so viel Verwüstung und Verlassenheit lief es einem schon kalt den Rücken hinunter.
Doch erst als sie das elende Schiff umrundeten und der bescheidene Rest des einstigen Großsegels allmählich den Blick auf einen am Mast flatternden Fetzen freigab, schnürte es allen bis zum letzten Mann buchstäblich die Kehle zu.
Читать дальше