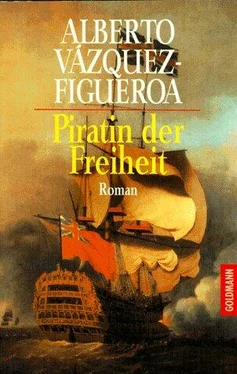Am nächsten Tag regte sich kein Blatt, und schon in den frühen Morgenstunden herrschte drückende Hitze. Doch am Nachmittag schleppten zwei große Ruderboote mit jeweils zehn Mann Besatzung die riesige Galeone langsam aus der ruhigen Bucht. Bei Sonnenuntergang erhob sich gewöhnlich auf dem offenen Meer eine leichte Brise, die man einfangen konnte.
Kapitän Buenarrivo überwachte jedes Detail des schwierigen Manövers. Einige Meter hinter ihm standen Celeste und Miguel Heredia unter dem Zeltdach des Achterkastells und winkten Madame Dominique, Oberst Buchanan und Ferdinand Hafner, die ihnen von Land aus eine gute Reise wünschten, zum Abschied zu. Als man jedoch die Barriere zwischen der riesigen Lagune und dem offenen Meer passierte, mußte das Mädchen mit Wehmut an jenen anderen, kaum ein Jahr zurückliegenden Tag denken, an dem sie mit ihrem Bruder Sebastian zum ersten Mal die schöne Silhouette von Port-Royal erblickt und die perfekte Lage dieser einzigartigen Stadt bewundert hatte.
Jetzt war ihr Bruder tot, und die Stadt lag in Schutt und Asche.
Zwei Meilen vor der Küste holte man die Ruderboote ein, setzte die Segel und wartete auf Wind. Nachdem der Venezianer überprüft hatte, daß jeder Mann auf seinem Posten war, wandte er sich an Celeste: »Kurs?«
»Südsüdwest. Ich möchte im Morgengrauen vor Black River ankern.«
Die Nacht war ruhig, und die milde Brise duftete nach feuchter Erde. Die meisten Besatzungsmitglieder waren heilfroh, die Freiheit des Meeres wieder zu spüren. Monatelang hatten sie sich wie Gefangene auf einer Insel gefühlt, die urplötzlich jeglichen Zauber verloren und sich in einen unerträglichen Kerker verwandelt hatte.
Ohne das schamlose Port-Royal mit seinen fröhlichen Huren und Schenken war Jamaika nur noch ein heißer und feuchter Ort. Bemerkenswert waren hier jetzt nur noch die Größe und Angriffslust der Moskitos. Allein die Tatsache, dieser widerwärtigen Plage entronnen zu sein, machte die Mannschaft froh und glücklich. Eilends brachten die Männer ihre Hängematten an Deck und spannten sie zwischen die Masten, um sorglos unter einem Sternenhimmel zu schlafen.
Wahrscheinlich fragten sich die meisten, wie lange ihre Reise dauern, an welch entlegenen Ort sie dieses Wagnis bringen würde. Aber sie lebten schon seit einiger Zeit für das Abenteuer, und die Tatsache, auf einem Schiff zu fahren, dessen Ziel man nicht kannte, war für sich allein schon vielversprechend genug.
Von Zeit zu Zeit musterten sie das — jetzt weite Männerkleidung tragende — Mädchen. In ihren Händen lag das Schicksal der mächtigen Galeone. Manch einem war nicht wohl dabei, auf die Befehle einer zarten Frau hören zu müssen, doch waren die meisten der Auffassung, daß die »Silberdame« genug Beweise geliefert hatte, daß sie mehr Mumm in den Knochen hatte als das größte Schlitzohr unter den alten Piratenkapitänen.
Über ihr kurzes Leben und ihre dunkle Vergangenheit waren tausend Gerüchte in Umlauf. Sicher wußte man nur, daß sie gemeinsam mit ihrem Bruder gesegelt war, dem schon legendären Kapitän Jacare Jack, und der hatte sogar Mombars dem Todesengel den Garaus gemacht. Das allein war schon eine hervorragende Empfehlung.
Am nächsten Tag gingen sie eine gute halbe Meile vor Black River vor Anker. Im ersten Morgenlicht zeichnete sich das prunkvolle Herrenhaus von Stanley Klein ab, dessen riesige Plantage bis zum Horizont reichte. Auf einer Anhöhe, lediglich zweihundert Meter vom Strand entfernt, stand die weiße Zuckermühle.
Celeste suchte mit einem großen Fernglas die gesamte Hacienda ab und, ohne sich umzudrehen, befahl sie dem Kapitän, der hinter ihr stand:
»Kanonenschächte öffnen!«
Ein Pfiff ertönte.
»Kanonenschächte öffnen!«
»Warnschuß abfeuern!«
»Warnschuß abfeuern!«
Fünf Kanonen spuckten Feuer. Auf der Stelle liefen zahlreiche Menschen am Strand zusammen und blickten ängstlich bis überrascht auf das mächtige Schiff, das sie von See aus bedrohte.
Das Mädchen betrachtete sie mit dem Fernglas, und als sie die riesige Gestalt des froschgesichtigen Sklavenhändlers ausmachen konnte, huschte ein Lächeln über ihr Gesicht.
»Es ist an der Zeit, Mr. Klein unsere Nachricht zu übermitteln«, murmelte sie und wies auf die Zuckermühle. »Schießt sie in Stücke! Aber daß mir das Haus unversehrt bleibt.«
Die Kanoniere zielten sorgfältig, und als der Pfiff ertönte, zündeten sie die Lunten.
Zehn zweiunddreißigpfündige Kanonenkugeln pfiffen durch die Luft. Sechs von ihnen schlugen mitten in dem weißen Gebäude ein. Was blieb, war ein Trümmerhaufen, den eine Staubwolke einhüllte.
Eine kurze Weile schauten sie zu, wie Schwarze und Weiße außer Atem über den Strand liefen. Dann schob Celeste Heredia seelenruhig das Fernglas zusammen und meinte:
»Das dürfte reichen. Ich nehme an, unser guter Freund Klein hat die Botschaft verstanden. Kurs Margarita.«
Der Venezianer blickte seinen Ersten Offizier an und befahl ihm fast gleichmütig:
»Schächte schließen, Anker lichten, Groß- und Focksegel setzen, Kurs steuerbord.«
Natürlich gab es von vorn nach achtern sofort Gerede. Vom Mastkorb bis herunter in die Küche, in der man gerade das Frühstück zubereitete, fragten sich alle, was diese ungewöhnliche Aktion bedeuten konnte. Was war noch alles von einer Frau zu erwarten, die eine bestimmt nicht billige Zuckermühle so selbstverständlich in Stücke schießen ließ, als würde es sich um Rosenstöcke im Garten handeln, die beschnitten werden müssen.
Als sie mit Kapitän Buenarrivo, dem Ersten Offizier, Miguel Heredia und Gaspar Reuter zu Mittag aß, bemerkte Celeste, die am Kopf der Tafel saß, beiläufig:
»Vier Kanonen haben ein festes und recht nahes Ziel verfehlt. Das darf nicht wieder vorkommen.«
»Wir sorgen dafür.«
Das Mädchen wandte sich an den Venezianer, der links neben ihr saß.
»Ich verlasse mich darauf. Und jetzt ist wohl der Augenblick gekommen, der Besatzung das Ziel unserer Mission zu erklären. Aber eines sollte klar sein: Wer dann nicht mehr an Bord bleiben möchte, erhält die Heuer für einen Monat und kann auf Margarita an Land gehen, ohne daß ihm jemand den geringsten Vorwurf macht.«
Am gleichen Nachmittag ließ der Kapitän die gesamte Besatzung auf Deck antreten, lehnte sich an die Reling des Achterkastells und erläuterte ihnen, so knapp er konnte, die Gründe, warum sie an Bord waren.
Danach herrschte langes Schweigen. Celeste Heredia nutzte die Gelegenheit, um aus ihrer Kajüte zu treten. Alle blickten sie erwartungsvoll an.
»Eins solltet ihr noch wissen«, sagte sie. »Außer eurer jeweiligen Heuer spendiere ich der Mannschaft für jeden befreiten Sklaven eine Golddublone.«
Die Menge murmelte Zustimmung, und eine anonyme Stimme aus den letzten Reihen wollte wissen:
»Wie viele Schwarze sind denn gewöhnlich auf einem Sklavenschiff?«
»Zwischen fünfhundert und tausend.«
»Heißt das, daß Ihr bereit seid, jedes Mal, wenn wir eines dieser Schiffe kapern, fast tausend Dublonen zu verteilen?«
»So ist es.«
»Und was habt Ihr davon?«
Das Mädchen musterte die ungläubigen, von Sonne und Wind gegerbten Gesichter. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht:
»Wer das nicht versteht, dem kann ich es auch nicht erklären. Er soll einfach gehorchen oder auf Margarita an Land gehen.«
Sie drehte sich um und verschwand wieder in ihrer Kajüte. Natürlich brodelte die Gerüchteküche erneut. Auf Deck, im Speiseraum und in den Mannschaftsquartieren sprach man tagelang von kaum etwas anderem: Man fuhr auf dem Schiff einer seltsamen Frau, die wahrscheinlich verrückt war.
»Verrückt oder nicht«, lautete schließlich die fast einmütige Meinung. »Jedenfalls hat sie das Geld, um ihre Versprechen zu halten, und wir fahren auf dem momentan besten Schiff aller sieben Weltmeere.«
Читать дальше