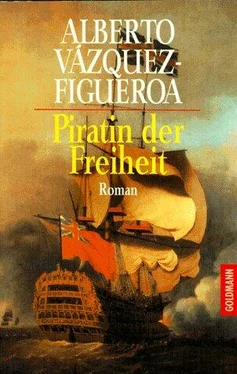»Meine Liebe…!« begann die ehemalige Kupplerin und zeigte den Anflug eines Lächelns. »Das Leben hat mich gelehrt, daß nur auf wenige Dinge Verlaß ist. Nicht einmal auf die Erde unter unseren Füßen. Du paßt einen Augenblick nicht auf und schon bebt sie. Aber wenn ich schon die Chance habe, meine Tage ohne finanzielle Sorgen in diesem Paradies zu beschließen, und das, ohne mich Tag für Tag mit Huren und Saufköpfen herumschlagen zu müssen, und im Gegenzug dafür lediglich Eure Neger als menschliche Wesen behandeln muß, warum sollte ich dann so dumm sein, sie zu schikanieren?«
»Klingt logisch.«
»Ist es auch.« Die elegante Dame fächelte sich Luft zu, musterte ihre Gesprächspartner und fügte in etwas verändertem Ton hinzu: »Wenn Euch das etwas hilft: Ich gehöre zu den wenigen, die wissen, wie man mit Stanley Klein umzugehen hat.«
»Kennt Ihr ihn sehr genau?« interessierte sich Miguel Heredia mit etwas krankhafter Neugier.
»Zu gut! Er ist ein arroganter Pinsel, ehrgeizig und vulgär. Am liebsten würde er es mit der ganzen Welt aufnehmen. Doch unterhalb der Gürtellinie erlahmt seine Energie.« Sichtlich angeekelt schüttelte sie den Kopf. »Genau deshalb ist er so gefährlich: Er weiß, daß er eigentlich nur ein aufgeschwemmter Hüne ist, verbittert und voller Komplexe. Eines meiner Mädchen hat ihm einmal gesagt, er würde die Welt nicht mehr hassen, wenn sein Schwanz nur so groß wäre wie seine Nase.« Sie schnalzte mit der Zunge. »Er verpaßte ihr eine Ohrfeige. Später aber betrank er sich und heulte sich darüber aus, wie schwer es sei, >viele tausend Sklaven zu haben, aber nicht einmal ein Zehntel der Männlichkeit eines Negers<. Ganz ehrlich, einen Augenblick lang tat er mir leid, aber er ist wirklich ein Schwein.«
»Könnt Ihr ihn unseren Leuten vom Leib halten?«
Madame Dominique nickte überzeugt.
»Wenn Eure Leute mitmachen.«
Drei Tage später rief Miguel Heredia fast fünfzig Arbeiter der Hacienda zusammen, die sich unter die schattigen SamanBäume vor der Seitenveranda des Hauses setzten. Nachdem er sie der Reihe nach gemustert hatte, wobei er versuchte, sich an jeden einzelnen Namen zu erinnern, klärte er sie über ihre Situation und die Entscheidungen auf, die man um ihretwillen getroffen hatte.
»Wenn ihr euch anständig benehmt«, schloß er, »könnt ihr weiter hier leben, arbeiten, ohne zu schuften, und ihr werdet einen gerechten Lohn erhalten, den ihr ausgeben solltet, ohne Verdacht zu erregen. Wenn ihr also etwas braucht, sagt ihr das Madame Dominique, und die wird dafür sorgen, daß man es euch aus Kingston beschafft.« Er richtete drohend den Finger auf sie. »Aber wer hier herumstreunt, den Lohn in Rum umsetzt und damit prahlt, frei zu sein, bringt die übrigen in Gefahr und wird daher als Sklave verkauft.«
»Heißt das, daß wir frei sind, man uns aber in Wirklichkeit verkaufen kann?« wollte ein untersetzter Mann wissen. Die unzähligen kleinen Narben in seinem Gesicht verrieten, aus welchem entlegenen Stamm seiner afrikanischen Heimat er kam.
»Das bedeutet, daß ihr euch eure Freiheit Tag für Tag aufs neue verdienen müßt. Tatsächlich habt ihr nur zwei Feinde: euch selbst und den Rum.«
Diese deutliche Anspielung war beileibe nicht überflüssig. Die meisten Sklaven der jamaikanischen Brennereien pflegten sich tatsächlich immer wieder sinnlos zu betrinken, um für einige Stunden ihre schrecklichen Lebensumstände zu vergessen. Aber Alkohol und Umsicht, das wußte jeder, vertrugen sich nun einmal nicht.
Die durchaus erträglichen Arbeitsbedingungen der Schwarzen auf der Hacienda von Caballos Blancos waren allerdings absolut nicht mit der unmenschlichen Ausbeutung zu vergleichen, unter der die Mehrheit der Sklaven auf der Insel litt. Trotzdem waren auch einige von Celestes Leuten dem Alkohol verfallen.
Zwei von zehn Schwarzen, die Afrika auf Sklavenschiffen verließen, kamen niemals an ihrem Ziel in der Neuen Welt an. Schuld daran waren die fürchterlichen Zustände auf der Überfahrt. Ein weiterer fiel, kaum angekommen, einer Krankheit zum Opfer, zwei weitere pflegten sich das Leben zu nehmen, wenn ihnen klar wurde, daß es keinen Weg zurück in die Heimat gab.
Fast die Hälfte der Millionen von Afrikanern, die in den knapp drei Jahrhunderten des Sklavenhandels nach Amerika verschifft wurden, starb also, bevor man ihre Arbeitskraft ausnutzen konnte.
Dennoch waren Sklaven das beste Geschäft seit vielen Jahrhunderten.
Kein Wunder also, daß einige Tage später, als Celeste die Geschäftsräume von Ferdinand Hafner verließ, ein riesiger, von vier mißmutig dreinblickenden Leibwächtern bewachter Dickwanst sich dem Mädchen in den Weg stellte.
»Nur einen Moment!« bat er fast fordernd. »Wir müssen über eine Angelegenheit reden.«
»Reden?« wunderte sich das Mädchen sichtlich ungehalten. »Über was?«
»Über Eure Hacienda«, gab der Mann zurück. »Ich habe gehört, daß Ihr die Insel verlassen wollt, und ich würde sie Euch gerne abkaufen.«
»Daß wir eine Reise unternehmen, heißt noch lange nicht, daß wir die Insel für immer verlassen wollen«, gab ihm Celeste zu bedenken und zwang sich, Ruhe zu bewahren. »Und natürlich habe ich nicht die geringste Absicht, mein Haus, meine Sklaven oder meine Hacienda zu verkaufen.«
»Nichtsdestotrotz…«, warf der Riese mit drohender Stimme ein. Sein schmales Gesicht mit Glotzaugen und Hakennase erinnerte an eine Ente. »Ihr solltet Eure Sklaven loswerden. Das wird Euch Probleme ersparen.«
»Was für Probleme, wenn man fragen darf?«
»Probleme, die diese verfluchten Neger zu machen pflegen«, erläuterte der Dickwanst im gleichen Tonfall. »Mir ist zu Ohren gekommen, daß Ihr sie nicht richtig zu behandeln wißt.«
»Wie ich mit meinen Leuten umgehe, ist immer noch meine Sache, findet Ihr nicht?« Immer mühsamer rang Celeste um Ruhe.
»Nein, Senorita, da täuscht Ihr Euch«, erwiderte Stanley Klein und wurde laut. »Wie jemand die Neger behandelt, geht uns alle etwas an, denn jedes schlechte Beispiel schadet uns allen. Ich habe keine Lust, Jäger zu bezahlen, die meine Sklaven in diesen höllischen Bergen suchen.«
»Nun, mir ist jedenfalls noch keiner entflohen«, gab Celeste zurück. »Noch einmal: Was ich tue, ist meine Sache, und es gibt kein Gesetz, das mich daran hindern kann.«
»Nein…!« erwiderte der andere schroff. »Ein Gesetz vielleicht nicht, aber ich sehr wohl. Daher rate ich Euch, meinen Vorschlag zu bedenken und den Unsinn zu lassen. Ich werde Euch einen gerechten Preis zahlen.«
»Und falls ich ablehne?«
»Dann müßt Ihr die Konsequenzen tragen. Und ich warne Euch, sie könnten unangenehm sein.«
Celeste Heredia dachte einen Augenblick lang nach, betrachtete ihr Gegenüber, dem sie kaum bis zur Brust reichte, und nickte schließlich.
»Einverstanden! Ich werde darüber nachdenken, und ich verspreche Euch, binnen zwei Wochen habt Ihr meine Antwort.«
»Gutes Mädchen!« erwiderte der andere mit triumphierendem Lächeln. »Ich erwarte Eure Nachricht.«
»Ihr bekommt sie«, lautete die orakelhafte Antwort. »Zweifelt nicht daran, Ihr werdet sehr bald meine Nachricht erhalten.«
Als sie auf die bereits fast seetüchtige Galeone zurückgekehrt war, mußte Celeste zu ihrer Überraschung feststellen, daß man die Galionsfigur des Bugs, eine schöne Meerjungfrau mit wallender Mähne und riesigen Brüsten, mit Silberfarbe gestrichen hatte. Noch verblüffter war sie, als man ihr den Grund dafür mitteilte.
»Wenn das Schiff schon Dama de Plata heißen soll, dann ist es doch logisch, eine Galionsfigur aus Silber zu haben«, fand der mutige Maler.
»Und wer hat bestimmt, daß sie so heißen soll?«
»Das drängt sich doch auf… Oder vielleicht nicht?«
»Ich hatte entschieden, daß sie Sebastian heißen wird!«
Читать дальше