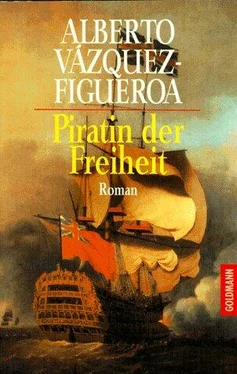Den Artilleristen, die an die fast vorsintflutlichen Kanonen des Forts gewohnt waren, kamen die modernen, mächtigen Geschütze der Galeone wie ein Wunderwerk der Technik vor. So verging kaum ein Tag, an dem sie nicht mindestens drei Stunden lang Schießübungen veranstalteten.
Alle an Bord der Dama de Plata wußten sehr wohl, daß die eigenen Kanonen in der Stunde der Schlacht ebenso gefährlich sein konnten wie die des Feindes. Wenn man sie nicht nach jedem Schuß sorgfältig reinigte, etwas zuviel Ladung nahm oder sich das Pulver aus Versehen entzündete, ging der Schuß nur zu oft nach hinten los, erledigte den Schützen und entfachte einen heftigen Brand, der um so gefährlicher war, je näher er an der Wasserlinie lag.
»Eine feindliche Kugel kann töten, einen Mast kappen und sogar ein für die Zimmerleute schwer zugängliches Leck schlagen«, pflegte Hauptmann Mendana seinen Männern einzuschärfen. »Aber ein Brand im Kampfgetümmel kann ein Schiff im Handumdrehen versenken.«
Aus diesem Grund befand sich das Pulvermagazin im tiefsten Inneren des Schiffs, unter dem dritten Deck, in einer mit dicken Kupferplatten ummantelten Kammer. Diese war nur über eine schmale Treppe oder eine winzige Bodenklappe zu erreichen, durch die sich die Schiffsjungen die Pulversäcke für die entsprechende Kanone hinausreichten.
Atemlos liefen die Schiffsjungen von dort durch die Gänge und über Treppen hinauf bis zum Standort des Geschützes. Dort übergaben sie das Pulver dem verantwortlichen Kanonier und kehrten auf anderem Weg zur Pulverkammer zurück, um nicht mit einem zusammenzustoßen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.
Es war ein unaufhörliches Kommen und Gehen, Befehle und Rufe erschallten, während Explosionen zu hören waren, denen ein schwarzer und ockerfarbener Rauch folgte. »Übung macht den Meister«, lautete der Spruch von Sancho Mendana, und das meinte er so.
Sollte man es tatsächlich, was Gott verhindern mochte, mit der Cagafuego oder einem anderen der riesigen englischen, holländischen oder portugiesischen Kriegsschiffe aufnehmen müssen, stand man einer erfahrenen und zahlenmäßig um das Dreifache überlegenen Besatzung gegenüber. Von dieser »Seeinfanterie« geentert zu werden bedeutete die sichere Vernichtung.
Um es gar nicht erst zum Entern kommen zu lassen, mußte man über eine klar überlegene Artillerie verfügen. Da alle Schiffe aber ähnliche Tonnage und Bewaffnung aufwiesen, war diese Überlegenheit nur durch hohe Zielsicherheit zu erreichen.
Mendana war ein Experte für Küstenartillerie. Daher ließ er seine Männer die sogenannten »Kettenschüsse« üben, die Seekanoniere in der Regel ablehnten. Man feuerte eine große Eisenkugel ab, die beim Austritt aus dem Rohr in zwei Teile zerbarst, die durch eine lange und dicke Kette miteinander verbunden blieben.
Die wild rotierenden Kugelhälften schlugen auf dem feindlichen Schiff alles entzwei, was sich ihnen in den Weg stellte, oder sie wickelten sich um die Aufbauten, kappten die Masten und zerfetzten die Segel so sehr, daß der Feind binnen kurzer Zeit nahezu manövrierunfähig wurde.
Einem rechten Seewolf, der etwas auf sich hielt, war eine so üble Finte zuwider. Der schnurrbärtige Margariteno führte dagegen — mit Recht — ins Feld, daß man sich im Leben in gewissen Augenblicken abwegige Sentimentalitäten nicht leisten konnte.
»Wenn es hart auf hart kommt, sind die Kettenkugeln vielleicht unsere Rettung, und ich verspreche euch, daß ich sie nur einsetzen werde, wenn es uns wirklich an den Kragen geht«, besänftigte er aufkeimenden Widerstand. »Aber wir brauchen die Sicherheit, daß sie da sind und wir auch damit umgehen können, wenn uns der Feind zahlenmäßig und an Waffen überlegen ist.«
»Das ist Schurkerei«, beschwerte sich der Erste Offizier.
»Eine größere Schurkerei wäre es, wenn vierhundert Männer dein Schiff entern und dir die Kehle durchschneiden«, schallte es gallig zurück.
Aus solchen Diskussionen hielt sich Celeste tunlichst heraus. Allerdings fand auch sie, daß man die Männer ständig auf Trab halten mußte, denn Langeweile und eine laxe Einstellung wurden der Mannschaft auf langen Überfahrten oft zum Verhängnis.
Daher befahl sie den Zimmerleuten, aus einem leeren Wasserfaß ein einfaches Floß mit Segel zu bauen, das man ins Meer warf. Dann schickte sie Segel- und Toppsgasten auf die Masten und ließ das Schiff einen weiten Kreis um das Ziel fahren, auf das sich die Kanoniere einschießen konnten.
Außerdem bestand sie darauf, daß alle Zeitpläne auf den Schlag einer Glocke genau eingehalten wurden. Dabei herrschte die gleiche Strenge wie bei der britischen Kriegsflotte. So hatte jedes Besatzungsmitglied bald eine sehr klare Vorstellung von seiner Aufgabe auf einem Schiff, auf dem alles mit der Präzision eines Uhrwerks ablief. Inzwischen entfernte sich die Dama de Plata allmählich von den Küsten der Neuen Welt.
Jeden Tag zeigte sich aufs neue, daß Celeste nicht nur ein standfestes und entschlossenes Mädchen war, das sich in den Kopf gesetzt hatte, eine so schwierige und in den Augen der Mehrheit nutzlose Mission durchzuführen, sondern daß sie außerdem — und vielleicht in erster Linie — eine tüchtige Organisatorin war, die ganz genau wußte, und das auch noch im voraus, wie sie sich zu verhalten hatte.
Diskret hielt sie Abstand zu den Männern, besonders zu den jüngsten. Mit Hochmut hatte das allerdings nichts zu tun, ganz im Gegenteil: Stets war sie für alle zugänglich, die ihre Hilfe oder ihren Rat benötigten.
Zwar trug sie weite, schmucklose Männerkleidung, doch ihre lange, dunkle schöne Mähne ließ sie stets im Wind flattern. Damit machte sie wohl klar, daß sie sich zwar immer noch als Frau ansah, ihr Geschlecht jedoch nichts mit ihren Pflichten zu tun hatte und sie als Ausrüsterin eines Schiffs so erfahren war wie der schmierigste und übelriechendste Kaufmann aus Lissabon oder Liverpool.
Ihr Gerechtigkeitssinn an Bord wurde erstmals in der Woche gefordert, als die Möwen vor der Küste von Guyana nicht mehr zu sehen waren. Da beschwerte sich ein junger Mann, der am Davit als Wachposten eingeteilt war, einer seiner Gefährten im Schlafsaal habe ihm während seiner letzten Wache die Golddublone gestohlen, die jedes Besatzungsmitglied als »Vorschuß« erhalten hatte.
»Na schön, mein Junge«, räumte Kapitän Buenarrivo ein, der gerade neben dem Mädchen auf dem Achterkastell stand. »Man hat dich also bestohlen. Denk aber daran, daß das eine schwere Anschuldigung ist. Hast du eine Ahnung, wer der Schuldige sein könnte?«
»Jeder im Schlafsaal, wie gesagt.« Der Angesprochene war sich seiner Sache sicher. »Kein Außenstehender, denn ich stehe genau vor dem Eingang Wache. Ich hätte also sehen müssen, wenn einer hineingegangen wäre.«
»Und wie viele Männer schlafen in diesem Raum?«
»Sechzehn, mich eingeschlossen.«
»Sollen wir also unter fünfzehn Verdächtigen herausfinden, wer deine Golddublone hat?« murmelte der Venezianer konsterniert. »Das wird sehr schwer sein, findest du nicht? Außerdem wird das viel böses Blut unter deinen Kameraden geben.«
»Daran habe ich schon gedacht, Kapitän«, gab der Bestohlene zu, der sein Geld offenbar unbedingt zurückhaben wollte. »Aber es gibt noch viel böseres Blut, wenn sie erfahren, daß ein Dieb unter ihnen ist, aber keine Ahnung haben, wer es ist.«
»Da hast du natürlich recht, aber wie soll ich das bloß anstellen? Schließlich kann ich ja nicht fünfzehn Männer foltern, bis einer gesteht.«
»Das ist mir schon klar«, entgegnete der andere mit bewundernswertem Selbstvertrauen. »Aber sie brauchen mir nur ihr Geld zu zeigen. Ich erkenne das meine.«
»Hast du es etwa markiert?«
»Nicht direkt. Aber ich erkenne es.«
»Bist du sicher?« mischte sich Celeste ein, die sich bis dahin aus der Diskussion herausgehalten hatte. »Ich habe keine Lust, wegen einer läppischen Dublone eine unangenehme Situation heraufzubeschwören, aber die Vorstellung, einen Dieb an Bord zu haben, gefällt mir noch weniger.«
Читать дальше