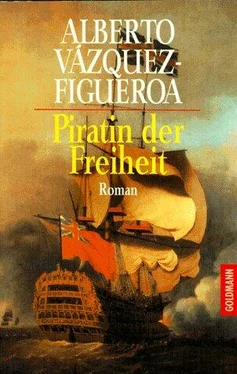»Ich denke, ich bin sicher, Senora«, kam es zurück. »Aber falls ich mich täusche, nehme ich jede Strafe auf mich, die Ihr über mich verhängen wollt.«
»Also einverstanden«, gab sich das Mädchen geschlagen. »Die Männer sollen an Deck kommen.«
Eine halbe Stunde später standen die fünfzehn Zimmergenossen des Schlafsaals in Reih und Glied auf dem Achterdeck und wurden vom größten Teil der Mannschaft kritisch beäugt. Nun befahl ihnen der Obermaat, die Taschen zu leeren und alles Geld, was sie besaßen, vor sich hinzulegen.
Alle gehorchten ohne Widerspruch. Der bestohlene Wachmann nahm eine Dublone nach der anderen in die Hand, untersuchte sie und roch schließlich daran.
Beim achten Versuch mußte er niesen.
»Das ist sie!« kam es wie aus der Pistole geschossen.
Kapitän Buenarrivo nahm die Dublone in die Hand, untersuchte sie akribisch und mußte schließlich zugeben:
»Ich kann nicht den geringsten Unterschied zu den anderen feststellen.«
»Riecht daran!«
Der Venezianer tat es und mußte sofort niesen.
»Seht Ihr?«
»Was hat das damit zu tun?«
»Ihr müßt niesen. Ich bewahre mein Geld stets in einem Beutel mit gemahlenem Pfeffer auf, und wenn nicht zu sehr daran gerieben worden ist, muß jeder niesen, der daran riecht.« Der Wachmann wies auf die Dublone und fügte in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete, Hinzu: »Die gehört mir!«
Celeste Heredia nahm die Münze in die Hand, roch daran und mußte sofort niesen. Darauf entwischte ihr ein Lächeln:
»Sehr gerissen, in der Tat!« kommentierte sie belustigt. »Wie heißt du?«
»Jeremias, Senora. Jeremias Centeno.«
»Und hast du noch mehr solcher Tricks auf Lager?«
»Einige, Senora. Mein Großvater war ein sehr schlauer Mann.«
»Wir werden darauf zurückkommen«, erwiderte sie und wandte sich dem mutmaßlichen Dieb zu. Der war leichenblaß geworden und hatte die Augen weit aufgerissen. »Hast du etwas dazu zu sagen?«
»Nichts, Senora«, hauchte er.
»Du gibst also zu, daß du ihn bestohlen hast?«
»Ja, Senora.«
Mit strenger Stimme fragte Celeste Heredia den Kapitän:
»Was für eine Strafe steht gewöhnlich darauf?«
»Fünf Peitschenhiebe und fünfzehn Tage bei Wasser und Brot im untersten Kielraum.«
Das Mädchen dachte lange nach, musterte den Angeklagten kritisch und verkündete schließlich laut und deutlich, damit auch jeder sie verstehen konnte:
»Ich dulde keine Diebe auf meinem Schiff. Weil er der erste war, bekommt er zehn Peitschenhiebe und einen Monat bei Wasser und Brot im Kielraum.« Drohend hob sie den Finger. »Aber beim nächsten Übeltäter wird die Strafe verdoppelt, beim dritten verdreifacht, und falls es wirklich einen vierten geben sollte, lasse ich ihn aufhängen. Ist das klar?«
»Absolut klar!« erwiderte der riesige Obermaat, ein blonder, über zwei Meter langer Schwede, im Namen aller. »Wirklich absolut klar!«
»Dann führt die Strafe aus. Hoffentlich müssen wir nicht noch einmal eine so traurige Erfahrung machen!«
Der Schuldige nahm die zehn Peitschenhiebe ohne den geringsten Schmerzenslaut entgegen. Anschließend führte man ihn in den tiefsten Kielraum, wo er einen Monat im Dunkeln bleiben würde, mit Ratten und Kakerlaken als einziger Gesellschaft. Auf dem Schiff kehrte wieder Routine ein, und in den folgenden Tagen rühmte die Besatzung die konsequente Haltung, mit der die scheinbar so zarte Silberdame die heikle Angelegenheit geregelt hatte.
»Die hat Mumm!« lautete der allgemeine Kommentar. »Verdammt viel Mumm!«
Eine Woche später, an einem grauen, bleiernen Morgen, ließ der Ausguck im Mastkorb schließlich den langersehnten Ausruf erschallen: »Schiff in Sicht!« Sofort stürzten sich alle, die in diesem Augenblick dienstfrei hatten, an die Reling, um den Horizont abzusuchen. Erwartungsvoll sah man den Kapitän an, um zu erfahren, was für ein Schiff sich näherte.
»Ein Pott mit gut sechshundert Tonnen«, meinte dieser schließlich. »Völlig überladen, aber nur armselig bewaffnet.« Er machte eine kurze Pause und nickte schließlich. »Ein Sklavenschiff, kein Zweifel.«
Es war tatsächlich ein Sklavenschiff, und zwar die Maria Bernarda. Dieser stinkende, schmutzige Pott war wohl einmal ein Schiff der spanischen Flotte gewesen. Schon beim ersten Warnschuß hißte er die weiße Flagge und drehte bei, denn mit seinen wenigen rostigen und minderwertigen Kanonen konnte er der vor Feuerkraft strotzenden stolzen Galeone natürlich keinerlei Widerstand leisten.
Bevor das heikle Entermanöver begann, verschwand Celeste in ihrer Kajüte und kehrte mit der Fahne zurück, die sie auf Jamaika hatte sticken lassen. Man hißte sie auf der Spitze des Großmasts, wo sie unter den erwartungsvollen Blicken von zweihundert Augenpaaren zu flattern begann.
Sie war riesengroß, hellgrün, und in der Mitte war in Schwarz eine dicke zerbrochene Kette gestickt.
Dann gelang es der Dama de Plata, längsseits des Sklavenschiffs zu gehen. Dessen Kapitän war ein halbnackter Marseiller, der sich völlig kahlgeschoren hatte, um sich auf diese Weise — wie fast alle seine Männer — die Heerscharen von Läusen, Flöhen und Zecken vom Leib zu halten, die offenbar das erbärmliche Schiff geradezu verseucht hatten. Verächtlich wies er auf die seltsame Fahne.
»Was zum Teufel soll das bedeuten?«
»Das heißt, alle Sklaven an Bord sind frei«, erwiderte der Venezianer in fast perfektem Französisch.
»Mit welchem Recht?«
Arrigo Buenarrivo wies vielsagend auf seine Kanonen.
»Reicht das?« fragte er sarkastisch.
»Vollkommen…«
»Dann kommt an Bord.«
Man legte ihm eine Planke hinüber, und geschickt balancierte der glatzköpfige Kapitän auf die Dama de Plata. Buenarrivo führte ihn in die Offiziersmesse, wo ihn Celeste, ihr Vater, Gaspar Reuter und Sancho Mendana erwarteten.
»Potzblitz!« grinste der Marseiller fast spöttisch. »Eine schöne weiße Frau! Was für ein Luxus!«
Ein strenger Blick aus Celestes dunklen Augen genügte, um ihm klarzumachen, daß diese »schöne weiße Frau« alles andere als Luxus war, sondern den Ton auf diesem imposanten Schiff, das ihn aufgebracht hatte, angab. Plötzlich klang der Marseiller sehr besorgt:
»Darf man erfahren, was das alles soll und was ihr vorhabt?«
»Die Sklaven zu befreien und dein Schiff zu verbrennen. Gut möglich, daß wir dich auch aufhängen lassen«, entgegnete das Mädchen in einem Ton, an dem es nichts zu deuteln gab. »Letzteres hängt ganz von dir ab.«
»Was habe ich zu tun?« erkundigte sich der glatzköpfige Kapitän. Er war unterwürfig und lammfromm geworden.
»Mit uns zusammenarbeiten.«
»Wie?«
»Zunächst einmal erzählst du uns, wem das Schiff gehört, wo ihr die Sklaven an Bord genommen habt und was euer endgültiges Ziel ist.«
»Die Maria Bernarda gehört Monsieur Francois Diderot aus Le Havre. Wir sind in Abidjan mit gut 700 Sklaven aufgebrochen, allerdings sind etwa 90 unterwegs gestorben. Unser Zielhafen ist vermutlich Martinique.«
»Wie oft hast du diese Überfahrt schon als Kapitän eines Sklavenschiffs gemacht?«
»Das hier ist die dritte, allerdings hatte ich beschlossen, nicht mehr weiterzumachen, denn die Bedingungen sind einfach infernalisch. Wenn ich Euch einen Rat geben darf, dann haltet Abstand von der Maria Bernarda. Dort wimmelt es vor soviel Ratten, Kakerlaken, Läusen und anderen Parasiten, daß Ihr das Schiff nur zu streifen braucht, um Euch zu infizieren.«
Das Mädchen schaute ihn lange an und nickte schließlich überzeugt: »Ich werde deinen Rat beherzigen, denn allein der Gestank ist nicht auszuhalten. Kehr an Bord deines Schiffs zurück und rühr dich nicht vom Fleck, bis du weitere Befehle erhältst.« Sie drohte ihm mit dem Finger. »Und laß sofort alle Sklaven frei.«
Читать дальше