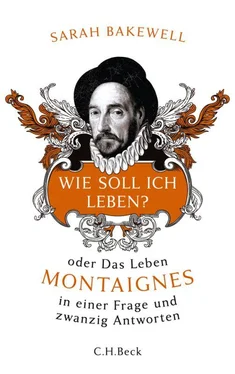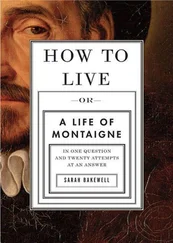Dieser Teil des Briefes war recht konventionell, doch dann wagte es Montaigne, dem neuen König eine Lektion zu erteilen. Formal respektvoll schrieb er ihm, er hätte sich gewünscht, Seine Majestät hätte sich den plündernden Soldaten seiner Armee gegenüber weniger nachsichtig gezeigt. Eroberungen seien nicht nur mit Waffen und Gewalt durchzusetzen, sondern müssten «mit Hilfe von Milde und Großzügigkeit» vollendet werden. Sie seien ein besseres Lockmittel als Strenge und Bestrafung, um die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Der König müsse zwar Stärke zeigen, zugleich aber auch Vertrauen in seine Untertanen setzen, um vom Volk mehr geliebt als gefürchtet zu werden.
Am 2. September sandte er ihm einen weiteren Brief. Heinrich hatte Montaigne erneut aufgefordert aufzubrechen, diesmal, um sich mit Matignon zu treffen. Er bot ihm an, die Kosten dieser Reise zu übernehmen. Aber auch diesmal ließ Montaigne sechs Wochen verstreichen, bevor er antwortete, und behauptete erneut, er habe den Brief gerade erst erhalten. Er habe, schrieb er, Matignon bereits drei Briefe geschickt und ihm angeboten, ihn aufzusuchen, jedoch keine Antwort erhalten. Vielleicht, so Montaigne, wolle ihm Matignon in Anbetracht «der Länge des Wegs und der Gefährlichkeit der Straßen» die Reise ersparen. Die Anspielung ist deutlich: Heinrich IV. sollte dieselbe Rücksicht zeigen. Die Erstattung der Spesen wies Montaigne zurück:
Ich habe niemals irgendeinen Vorteil von der Großzügigkeit der Könige genommen noch jemals einen solchen begehrt, geschweige denn verdient, und ich habe keinen Lohn für die Dienste erhalten, die ich ihnen geleistet habe und die Eurer Majestät zum Teil bekannt sind. Was ich für Ihre Vorgänger tat, werde ich noch viel bereitwilliger für Euch tun: Ich bin, Sire, so reich, wie ich es nur wünsche. Sollte mein Geldbeutel aber einmal leer und ich an der Seite Eurer Majestät in Paris sein, werde ich so kühn sein und mir erlauben, es Euch zu sagen.
Erstaunlich bestimmt, dieser Ton gegenüber einem König. Doch Montaigne war gealtert und krank (er lag mit Fieber im Bett), und er kannte den König gut genug, um offen reden zu dürfen. In den Essais schrieb er: «Ich betrachte unsre Könige mit einer lediglich von Gesetzestreue und Bürgerpflicht bestimmten Anhänglichkeit, die meine Privatinteressen nicht mehren und nicht mindern […]. Das ist es, was mich stets erhobnen Hauptes einherschreiten lässt, offenen Herzens und offenen Blicks.» Sein Brief an Heinrich IV. zeigt, dass er diese Einstellung auch in der Praxis beherzigte. Montaigne tritt uns in diesen beiden Briefen so vor Augen wie in den Essais: freimütig, unbeeindruckt von der Macht und entschlossen, sich seine Freiheit zu bewahren.
Vielleicht entdeckte er bereits Anzeichen dessen, was zu einem Grundzug der Regierungszeit Heinrichs IV. werden sollte: die Tendenz zum Personenkult. Einen starken Herrscher wie ihn brauchte das Land nach all den schwachen und unentschlossenen Königen zwar dringend, aber ein Freund subtiler Reflexionen war Heinrich IV. nicht. Kurze Reden und rasches, entschlossenes Handeln waren sein Stil. Statt sich regelmäßig zu waschen und zum Essen die Gabel zu benutzen wie Heinrich III., war er schmuddelig und stank angeblich wie verfaultes Fleisch. Doch er besaß Charisma. Montaigne gefiel die Vorstellung eines starken Königs, aber für Selbststilisierung hatte er nichts übrig. In den Essais schrieb er über Heinrich IV. mit verhaltener Zustimmung, nicht mit blinder Unterwürfigkeit. Auch in seinen Briefen wahrte er Distanz. Diesen Kampf gewann er, denn er brach nie auf, um sich dem Gefolge des Königs anzuschließen.
Anfang 1595, erst nach Montaignes Tod, begann Heinrich IV. den Krieg gegen einen äußeren Feind, Spanien, und entzog damit den Bürgerkriegen, die 1598 endeten, Kräfte und Ressourcen. Jetzt begann Frankreich als Nation allmählich zusammenzuwachsen, auch wenn der Einigungsprozess fragil und an die Person des Herrschers gebunden blieb. Viele waren ihm in leidenschaftlicher Treue ergeben, andere hassten ihn nicht weniger leidenschaftlich. Auch er wurde schließlich ermordet: 1610 erstach ihn der fanatische Katholik François Ravaillac.
Einer seiner wichtigsten Beiträge zur französischen Geschichte war das Edikt von Nantes vom 13. April 1598, das beiden Konfessionen Gewissensfreiheit und den Protestanten Kultfreiheit gewährte. Aus dem Land, das unter den religiösen Streitigkeiten am meisten zu leiden hatte, wurde der erste westeuropäische Staat, der offiziell zwei christliche Konfessionen anerkannte. In einer Rede vor dem Parlament am 7. Februar 1599 betonte Heinrich, das Edikt sei nicht, wie die vorausgegangenen, dem Wunsch entsprungen, es allen recht zu machen, und dürfe nicht als eine Lizenz betrachtet werden, Unruhen zu schüren. «Ich werde alle Fraktionsbildungen und alle aufrührerischen Predigten im Keim ersticken; und ich werde jeden enthaupten lassen, der dazu aufruft.»
Das Edikt von Nantes, erlassen mit einer Entschlossenheit und beherzten Zuversicht, die Montaigne gefallen hätte, blieb fast hundert Jahre in Kraft. Als es 1685 widerrufen wurde, flohen viele Hugenotten nach England und in andere Länder. Zu diesen Flüchtlingen gehörten auch zahlreiche Leser Montaignes, unter ihnen Pierre Coste, dessen Samisdat-Edition der Essais über den Kanal nach Frankreich zurückgelangte und seine leidgeprüften Landsleute mit einem neuen und revolutionären Montaigne bekannt machte.
16
Frage: Wie soll ich leben?
Antwort: Philosophiere nur zufällig!
Fünfzehn Engländer und ein Ire
In dem gesamten Jahrhundert, bevor Coste dem Verfasser der Essais 1724 zu einem neuen Image verhalf, ließen die Engländer in ihrer Bewunderung für Montaigne nicht nach. Sie waren die Ersten außerhalb Frankreichs, die sich Montaigne aneigneten und fast als einen der Ihren betrachteten. Die englische Mentalität schien genau auf seiner Wellenlänge zu schwingen, in vollkommener Harmonie, während sich anderswo tiefe geistige Umbrüche vollzogen.
Die Geschichte von Montaignes «Nachleben» wurde in diesem Buch bisher parallel zu seiner Lebensgeschichte erzählt, und zwar vorerst bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Jetzt scheint es geboten, einen Augenblick innezuhalten, um seinen Erfolg jenseits des Kanals genauer zu betrachten — in einem Land, das zu besuchen ihm offenkundig niemals einfiel. Dass er dort gleichsam als Flüchtling aufgenommen wurde, hätte ihn in höchstem Maße überrascht, zumal es ein protestantisches Land war.
Die Religion war einer der Gründe, warum viele englische Leser seit dem späten 17. Jahrhundert die Freiheit hatten, Montaigne zu lesen. Den englischen Protestanten war es egal, dass die katholische Kirche sein Buch auf den Index gesetzt hatte, es verschaffte ihnen sogar die Genugtuung, den Katholiken eins auszuwischen — und noch mehr den Franzosen. Diese schienen ohnehin unfähig, ihren besten Autoren die angemessene Wertschätzung entgegenzubringen, zumal die Académie Française der französischen Literatur strenge Maßstäbe auferlegte. «Ein form- und regelloses Daherreden», wie Montaigne sein eigenes Schreiben charakterisierte, hatte in dieser neuen französischen Ästhetik keinen Platz. Die englische Sprache nahm ihn dagegen auf wie einen verlorenen Sohn. Das Englische, das überbordende und anarchische Idiom Chaucers und Shakespeares, schien für diesen Autor die genuine Sprache zu sein. Lord Halifax, dem eine Übersetzung des 17. Jahrhunderts zugeeignet ist, bemerkte, Montaigne zu übersetzen sei «für uns nicht nur ein immenser Gewinn, sondern ein gerechter Tadel der kritischen Impertinenz jener französischen Skribenten, die große Mühe darauf verwendet haben, an ihm herumzukritteln, um den Ruf dieses großen Mannes zu schmälern, den die Natur zu groß gemacht hat, um sich in die engen Grenzen eines bemühten Stils zwängen zu lassen». Und der Essayist William Hazlitt vereinnahmte Montaigne — und Rabelais — in einem Text mit dem Titel «On Old English Writers and Speakers» kurzerhand als englische Autoren, was er mit den Worten begründete: «Diese betrachten wir als in hohem Maße englisch oder als das, dem die altfranzösische Wesensart zuneigte, bevor sie durch Höfe und Akademien der Kritik korrumpiert wurde.»
Читать дальше