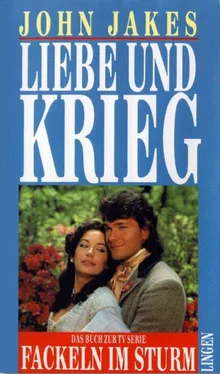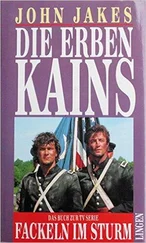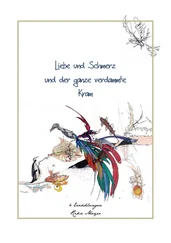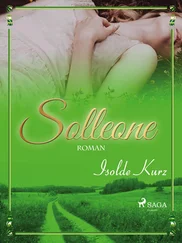Charles brachte die Solingen-Klinge hoch und traf Cuffey an der Innenseite des rechten Handgelenks. Blut spritzte. Cuffey ließ das Messer los, das so dicht an Charles’ Ohr vorbeizischte, daß er das Metall an seinem Ohrläppchen spürte.
Charles kniete immer noch. Cuffey trat gegen seinen linken Arm. Er kippte weg, rollte herum. Cuffey stampfte mit seinem schweren Stiefel auf Charles’ ausgestreckten rechten Arm. Seine Hand öffnete sich. Er verlor den Degengriff.
Mit einer Grimasse – ein Lächeln konnte man es nicht nennen – ließ sich Cuffey mit beiden Knien auf Charles’ Brustkorb fallen. Charles bekam ihn zu fassen, und sie rollten auf dem mit Scherben übersäten Boden herum. Charles hielt die schwarze Hand fest, die wie eine Klaue nach seinen Augen schlug, aber er spürte, wie seine Kräfte schnell schwanden.
»Werd-dich-töten-weißer-Mann.« Keuchend riß Cuffey seinen Arm aus Charles’ blutenden, glitschigen Fingern los. Seine beiden Hände krallten sich um Charles’ Hals.
»Bist erledigt. Wie – alles hier – «
Und so schien es tatsächlich zu sein. Schmerz und Schock betäubten Charles. Die Hände drückten zu, schlossen sich unbarmherzig fester und fester. Charles’ blutrote Finger berührten und schlossen sich um etwas, was er nicht sofort identifizieren konnte –
Der geriffelte Degengriff.
Aus den Augenwinkeln sah Cuffey ihn kommen. Charles rammte den leichten Degen in Cuffeys linke Seite, gerade unter seinen Arm. Gleichzeitig ließ Cuffey die blutbeschmierte Kehle von Charles los und wich vor dem Degen zurück. Die Spitze war bereits durch die gelbe Seide gedrungen und glitt nun tiefer. Fünf Zentimeter. Zehn. Fünfzehn –
Charles spürte, wie die Klinge an einem Knochen abrutschte und weiterglitt. Fünfundzwanzig Zentimeter. Dreißig –
Jetzt kreischte Cuffey, sprang auf und krümmte sich, den tödlichen Stahl tief in seinem Leib. Charles hielt fest. Die Klinge brach direkt vor dem Griff, einige Zentimeter von dem Kleid entfernt. Cuffey zerrte wie verrückt an dem Stahl, schwankte und kreiselte in das brennende Wohnzimmer. Das bauschige Kleid fing Feuer. Flammen liefen den Saum entlang, sprangen nach oben. Drehend und rudernd tanzte Cuffey seinen Todeswalzer, ehe er in das Feuer stürzte.
Die Flammen fanden neue Nahrung, stiegen höher. Charles bekam von Cuffey nichts mehr zu sehen.
Die rauchende Decke krachte und sackte durch. Charles kämpfte sich auf die Füße. Sein rechtes Hosenbein war blutgetränkt. Er erspähte seinen Colt und nahm ihn wieder an sich. Die Fenster im Salon waren herausgeschlagen worden; vermutlich waren Cooper und die anderen auf diesem Weg geflüchtet. Er mußte sie finden. Das große Haus war verloren.
Das Tageslicht dämmerte herauf. Cuffeys Gefolgsleute hatten fast alles Wertvolle an sich gerafft, bevor das Feuer das Haus zerstörte. Sie hatten die Wein- und Schnapsregale geleert, die Garderoben, die Küchenschränke. Er sah dreckige, bärtige Männer, Schwarze und Weiße, die beutebeladen durch die Rauchschwaden glitten.
Es wurde kaum noch geschossen. Aber eine Kugel genügte, und so hielt sich Charles vorsichtig hinter einer der weißen Säulen, als er rief: »Cooper?«
Schweigen.
»Cooper!«
»Charles?«
Die ferne Stimme wies ihm die Richtung. Sie hatten sich in dem Pflanzengewirr des ehemaligen Gartens am Fluß versteckt. Er kroch am Haus entlang, um die Ecke, vorbei am Kamin, spähte über den Rasen.
Niemand. Er wollte schon losrennen, dann fiel ihm ein, daß er noch etwas anderes verkünden mußte.
»Cuffey ist tot, Cooper. Cuffey – ist – tot. Ich habe ihn getötet.«
Die Geräusche des brennenden Mont Royal füllten die Stille. Aber die Stimmen schwiegen. Er wußte, daß sie ihn gehört hatten. Tief sog er die Luft in seine schmerzenden Lungen und rannte los, auf den Ashley zu.
Jemand schoß auf ihn. Die Kugel schlug in das feuchte Gras rechts von ihm, aber weitere Schüsse blieben aus. Im Garten sah er sich von vertrauten Gesichtern umringt. Ohne ein Wort fiel er ohnmächtig nach vorn.
Den ganzen Tag über versteckten sie sich in einem der Reisfelder. Die Gruppe der Überlebenden bestand aus Cooper, seiner Frau und seiner Tochter, Clarissa, Jane, Andy, einer jungen Küchenmagd namens Sue, ihren beiden kleinen Jungen und Cicero, dem alten, arthritischen Sklaven mit dem weißen Kraushaar. Charles lehnte unerbittlich jeden Vorschlag ab, zum Haus zurückzugehen.
»Nicht vor Anbruch der Dunkelheit. Dann gehe ich zuerst, allein. Sinnlos, noch weitere Menschenleben zu riskieren.«
Der Verband, den er sich noch im Haus angelegt hatte, war seiner Beinwunde gut bekommen. Sie hatte sich geschlossen. Er fühlte sich alles andere als gut, aber er konnte wach bleiben.
Gegen Sonnenuntergang verkündete Charles, daß er jetzt das Haus und die Umgebung inspizieren würde.
»Glaub nicht, daß einer allein gehen sollte«, sagte Andy. »Ich gehe mit.«
»Ich würde vorschlagen, wir gehen zu dritt«, sagte Cooper. Charles war mittlerweile zu müde, um zu streiten. Achselzuckend gab er nach.
Coopers ganze Aufmerksamkeit war auf das Haus gerichtet. Er flüsterte: »Oh, Gott im Himmel.« Selbst Andy schien erschüttert zu sein. Charles wollte nicht hinschauen, tat es dann aber doch.
Mont Royal war bis auf die Fundamente niedergebrannt; nur noch Schutt und Asche und der große, rauchgeschwärzte Kamin waren zu sehen.
»Wie konnten sie?« sagte Cooper mit zornbebender Stimme. »Wie konnten sie, diese verfluchten, ignoranten Barbaren.«
Sanft sagte Charles: »Wir haben nur bekommen, was du immer vorausgesagt hast.«
Er ging voraus und verschwand hinter dem Kamin. Plötzlich hörten Cooper und Andy ihn wie einen Verrückten lachen.
»Los, schnell«, sagte Cooper und rannte los.
Charles stand neben einer Leiche und brüllte wie ein Irrer. Die Ursache seines Heiterkeitsanfalls stand ein Stück weiter zur Einfahrt hin: ein großohriges Maultier mit Zügel und Haltestrick.
»Cuffeys Maultier!« japste Charles. »Mont Royal ist dem Erdboden gleichgemacht, aber ich habe ein Ersatztier. Gedankt sei Gott und Jeff Davis! Jetzt kann der Krieg weitergehen und weiter und weiter – «
Die irre Stimme brach. Er warf ihnen einen beschämten Blick zu und humpelte zur nächsten noch stehenden Eiche. Er lehnte sich mit dem Arm dagegen und verbarg sein Gesicht.
127
An diesem Sonntagmorgen, dem 2. April, verrichteten Mr. Lonzo Perdue und seine Frau und seine Töchter kniend ihr Gebet, als ein Bote durch die St. Pauls-Kirche eilte und dem Präsidenten etwas zuflüsterte. Mr. Perdue beobachtete, wie der weißhaarige Präsident unsicheren Schrittes die Kirche verließ. Mr. Perdue beugte sich zum Ohr seiner Frau.
»Die Verteidigungslinien sind durchbrochen. Hast du sein Gesicht gesehen? Wir müssen packen und einen Zug erwischen.«
Am Bahnhof wurden ohne offizielle Erklärung alle Züge zurückgehalten. Gegen Nachmittag wuchs die Menschenmenge immer stärker an und wurde immer unruhiger. Mr. Perdue und seine Familie wurden bis vor den Bahnhofseingang zurückgedrängt.
Bei Einbruch der Dunkelheit schwirrten wilde Gerüchte durch die riesige Menschenmenge. Es kam zu Gewalttätigkeiten; Soldaten mußten gegen den Mob vorgehen. Dann kam die erste Explosion.
»Oh, Papa!« rief Mr. Perdues Tochter und drängte sich gegen ihren genauso entsetzten Vater. »Was tun sie nur?«
»Gebäude zerstören.«
Gegen elf Uhr war die Stadt ein Nachtasyl, erleuchtet von sich ausbreitenden Feuern. Davis erschien in einer von schwer bewaffneten Soldaten umringten Kutsche. Ein Zug nach Danville warte auf ihn, sagte jemand.
Mr. Perdue begann Verrat zu wittern, als er gewisse andere Personen den Bahnhof betreten sah. Er entdeckte den Halunken Mallory, der so viele wertvolle Dollars mit seinen sinnlosen Marineplänen verschwendet hatte. Trenholm, der Memminger im Schatzamt abgelöst hatte, kam in einer Ambulanz an. Denn erschien Benjamin, glatt und fröhlich wie stets. Die Privilegierten wurden in Sicherheit gebracht.
Читать дальше