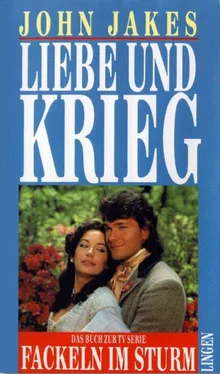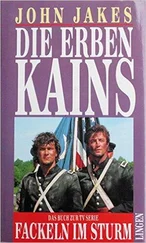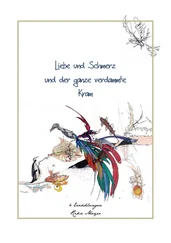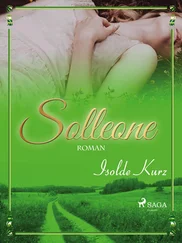Mit ihren gefälschten Papieren waren sie von Montreal nach Windsor und Detroit gereist, dann weiter nach Chicago und jetzt Anfang Februar nach St. Louis, wo sich ihre Wege trennen würden. Powell und ihr Mann würden mit der Überlandkutsche nach Westen fahren; sie sollte nach Santa Fe.
Am Nachmittag vor ihrer Abreise spürte Powell das Elend, das Ashton völlig ausfüllte, und riskierte einen Spaziergang mit ihr, während Huntoon sein Nickerchen hielt.
»Tut mir leid, daß wir uns für eine Weile trennen müssen«, sagte Powell. »Ich weiß, die Reise war problematisch.«
»Scheußlich.« Ashton schob die Unterlippe vor. »Mir fehlen die Worte, um auszudrücken, wie sehr mir dreckige Betten und billiges Essen zum Hals raushängen.«
In der Annahme, daß in dem geschäftigen Treiben am Fluß sie niemand kennen würde, legte Powell einen Arm um ihre Schultern.
»Ich versteh’ dich«, murmelte Powell. »Und vor uns liegen auch noch einige harte Tage.« Er streichelte ihre rechte Hand, und sie fragte sich, weshalb sie sich dabei so unbehaglich fühlte.
»Ich freue mich bestimmt nicht auf die Fahrt«, sagte sie, ohne zu lächeln.
»In der Kutsche wirst du vollkommen sicher sein. Du hast Geld für Notfälle.«
»Darum geht es nicht. Es ist eine weitere elende Reise.«
Er brauste auf. »Glaubst du, ich hab’s leichter? Ganz im Gegenteil. Ich muß zwei Wagen mit geheimer Fracht beladen – ständig auf der Hut vor Dieben. Dann muß ich diese Wagen ein paar hundert Meilen durch die Wildnis auf das Territorium von New Mexico transportieren. Im Vergleich zu dem Risiko könntest du dein Gejammer über eine relativ bequeme Kutschenfahrt ruhig einstellen.«
»Ja, du hast recht – ich entschuldige mich.« Die Erkenntnis, daß auch Powell in letzter Zeit ständig unter großer Anspannung gestanden haben mußte, besänftigte Ashton. Ein bißchen Farbe erschien in ihrem Gesicht, das während des Winters blaß und hager geworden war, weil sie so viel von dem schlechten Essen verweigert hatte. »Ich ertrage James einfach nicht mehr.«
»Vergiß nicht«, sagte er sanft, »daß wir eine sehr lange Reise vor uns haben. Wasserlose Wüste und die Bedrohung durch Indianer, da kann jedem meiner Soldaten, die mich begleiten, was passieren.«
Jetzt lachte sie, fühlte sich erleichtert. Ein kurzer Anfall von Mitleid für James überkam sie. Armer Soldat, kurz vor seinem letzten Feldzug. Aber dieses Gefühl ging schnell vorüber.
Einen halben Block entfernt, versteckt im Schatten einer hohen Mauer, schüttelte Huntoon den Kopf, fuhr mit einem Taschentuch unter seine Brillengläser und wischte sich heftig die Augen. Dann folgte er seiner Frau und Powell weiter am Fluß entlang, bis sie hinter einer Pyramide von Fässern verschwanden.
Wieder flossen die Tränen. Benommen, wütend zwinkerte er sie weg. Seit mehr als einem Jahr schon hegte er diesen Verdacht. Lamar, den er immer noch bewunderte, gab er keine Schuld. Der läufigen Hündin, die er geheiratet hatte, gab er die Schuld. Er hatte vorgegeben zu schlafen und war dann hinter dem Pärchen hergeschlichen, weil er einen einwandfreien Beweis benötigte. Er mußte nun einen zweiten Brief schreiben und ihr von dem ersten erzählen.
Er drehte sich um und ging schnell zu dem billigen Hotel zurück, in dem sie hausten.
Huntoon küßte in dem Tumult vor der Abfahrt Ashtons Wange und drückte ihr einen versiegelten Umschlag in die Hand. Mürrisch fragte sie: »Was ist das?«
»Nur – persönliche Sentimentalitäten.« Sein Lächeln war schlaff; er wich ihrem Blick aus. »Öffne ihn, wenn mir etwas zustoßen sollte. Aber nicht vorher. Schwöre, daß du mir diese Bitte erfüllst, Ashton.«
Sie würde alles tun, um von diesem fetten Narren fortzukommen. »Natürlich. Ich schwöre.«
Sie bot ihm ihre Wange zum Abschiedskuß. Huntoon drückte seinen Kopf gegen ihre Schulter, gab ihr so die Chance, Powell einen letzten, sehnsuchtsvollen Blick zuzuwerfen. Powell, sehr elegant an diesem Morgen, wirbelte seinen Stock herum und betrachtete das Liebespaar aus höflicher Entfernung.
Ungeduldig stieß Ashton Huntoon zurück. »Ich muß los.«
»Glückliche Reise, Liebes«, sagte er und half ihr in die Kutsche. Sie schaffte es, sich auf den letzten bequemen Sitz zu quetschen.
Sie untersuchte den Briefumschlag. Vorn hatte er Ashton draufgeschrieben und den Umschlag mit drei großen Tropfen Wachs verschlossen. Ihm schien viel daran zu liegen, daß seine Bitte erfüllt wurde, wenn er ihn so sorgfältig versiegelt hatte. Nun, bald schon würden es die Umstände erfordern, daß sie diesen Brief öffnete.
Lamar hatte Huntoon untergehakt und winkte mit seinem Stock. Ashton winkte fröhlich zurück. Powells forsches Benehmen und sein zuversichtliches Lächeln sagten ihr, daß sie sich wegen des Briefes keinem Irrtum hingab.
George arbeitete an einer Bahnbrücke der City-Point-Linie, die eine Schlucht überspannte.
»Scow? Ich gehe rüber zu diesem Bach was trinken. Bin gleich zurück.«
»In Ordnung, Major«, sagte der Schwarze.
George hakte die Blechtasse von seinem Gürtel und öffnete mit der anderen Hand seine Revolvertasche. Der Bach, außer Sicht der Bahnlinie, strömte nur wenige hundert Yards von der Front entfernt dahin. Aber es war Sonntag und noch früh, also rechnete er mit keiner Gefahr.
George kauerte sich am Ufer nieder und tauchte seine Tasse ins Wasser. Er führte sie gerade zum Mund, als ein Mann hinter einem Baum auf der anderen Seite hervortrat.
George ließ die Tasse fallen, verschüttete das Wasser. Seine Hand flog zu seinem Revolver. Der Reb hob schnell die rechte Hand, mit der Handfläche nach oben.
»Langsam, Billy. Ich will bloß einen Schluck trinken, genau wie du.«
George hielt den Atem an, blieb geduckt stehen, die Hand am Revolver. Der Reb, um einiges größer als er, mochte in seinem Alter sein, mit einem kränklichen Gesichtsausdruck. Sein Gewehr hielt er achtlos, den Lauf gen Himmel gerichtet.
»Bloß was zu trinken?« Der Reb nickte. »Hier.« George hob seine Tasse auf und warf sie über den Bach. Der Impuls war so plötzlich gekommen, daß er ihn nicht ganz begriff.
»Danke.« Der Reb ging oder hinkte vielmehr zum Wasser hinunter, tauchte die Tasse ein und trank gierig. Dann kam die Tasse, im Sonnenlicht aufblitzend, zurückgesegelt. »Noch mal vielen Dank, Billy.« George fing die Tasse auf, tauchte sie ein und trank ebenfalls. Der Reb erhob sich und wischte sich über die Lippen. »Wo kommst du her?«
»Pennsylvania.«
»Oh. Ich hatte gehofft, es sei Indiana.«
»Warum?«
»Mein Bruder lebt dort. Zog vor acht Jahren von Charlottesville auf eine kleine Farm außerhalb von Indianapolis. Er gehört zu einem Freiwilligen-Infanterieregiment. Dachte, du kennst ihn vielleicht. Hugo Hoffmann, mit zwei f.«
»Ich fürchte nein. Die Unionsarmee ist ganz schön groß.«
Hoffmann erwiderte das Lächeln nicht. »Viel größer als unsere.«
»Muß schlimm sein, einen Bruder auf der anderen Seite zu haben. Kommt aber oft genug vor. Cousins kämpfen gegeneinander – und Freunde. Mein bester Freund ist Colonel in eurer Armee.«
»Wie heißt er?«
»Oh, den kennst du nicht. Er ist in Richmond, in eurem Kriegsministerium.«
»Wie heißt er?«
Sturer Deutscher, dachte George. »Main, wie in Main Street. Vorname Orry.«
»Aber den kenne ich. Das heißt, ich habe von ihm gehört. Ist mir im Gedächtnis geblieben, weil es kein gewöhnlicher Name ist. Im letzten Herbst gab es einen Colonel Orry Main beim Stab von General Pickett.«
George konnte kaum sprechen: »Gab?«
»Ein Verwundeter, dem er helfen wollte, schoß von hinten auf ihn – ein Kavallerist von euch.« Groll schlich sich in seine Stimme; Hoffmanns grüne Augen wurden weniger freundlich. »Wurde viel über den Vorfall geredet, als Beweis für die Barbarei von General Grants Truppen.«
Читать дальше