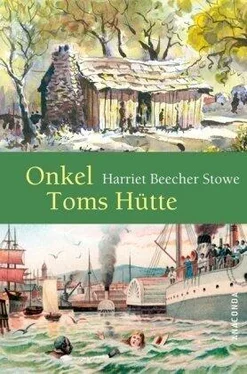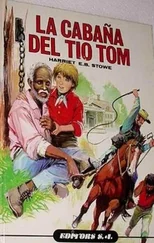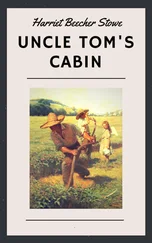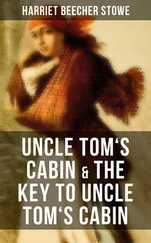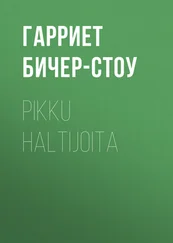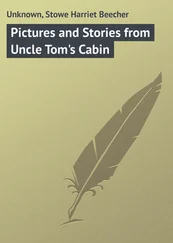»Weißt du schon, Tom, daß wir verkauft werden sollen?« sagte Adolf.
»Wo hast du das gehört?« fragte Tom.
»Ich verbarg mich hinter dem Vorhang, als die Herrin mit dem Anwalt sprach. In wenigen Tagen werden wir alle zur Auktion geschickt.«
»Des Herrn Wille geschehe!« erwiderte Tom, verschränkte die Arme und seufzte tief auf.
»Wir werden nie wieder einen solchen Herrn bekommen«, meinte Adolf ahnungsvoll; »aber lieber lasse ich mich verkaufen, als daß ich bei der Gnädigen bleibe.«
Tom wandte sich ab; sein Herz zersprang vor Weh. Die Hoffnung auf Freiheit, der Gedanke an seine fernen Lieben stand vor seiner geduldigen Seele, wie dem schiffbrüchigen Seemann kurz vor dem Hafen das Bild seines heimatlichen Kirchturms und der trauten Dächer seines Heimatdorfes nur zum letzten Lebewohlgruß auf dem Gipfel einer schwarzen Welle erscheint. Fest verschränkte er beide Arme über der Brust, schluckte die bitteren Tränen hinunter und versuchte zu beten. Seine arme, alte Seele trug ein solch unbezähmbares Verlangen nach Freiheit in sich, daß dies eine schwere Prüfung für ihn bedeutete; je mehr er zugab: »Dein Wille geschehe!«, um so elender fühlte er sich.
Er suchte Miß Ophelia auf, die ihm seit Evas Tod immer mit besonderer, respektvoller Freundlichkeit begegnet war.
»Miß Feely«, sprach er sie an, »der gnädige Herr hat mir meine Freiheit versprochen. Er sagte, er hätte es schon eingeleitet, und jetzt, wenn Miß Feely vielleicht so gut ist und mit der gnädigen Frau sprechen wollte, dann ließe es sich vielleicht weitertreiben, der Herr hat es doch gewünscht.«
»Ich werde ein Wort für dich einlegen, Tom, und mein Bestes versuchen«, antwortete Miß Ophelia; »aber wenn es von Mrs. St. Clare abhängt, kann ich dir nicht viel Hoffnung machen. Dennoch will ich es versuchen.«
Dieser Vorfall ereignete sich einige Tage nach dem ersten mit Rosa, als Miß Ophelia schon ihre Vorbereitungen traf, um nach Norden zurückzufahren.
Sie ging ernstlich mit sich zu Rate und überlegte, daß sie vielleicht bei ihrer letzten Unterredung mit Marie zu hitzig gegen sie Partei ergriffen hätte, und sie beschloß, diesmal ihren Eifer zu zügeln und so liebenswürdig wie nur möglich zu sein. Ihr Strickzeug mitnehmend, entschied sie sich, Marie sogleich aufzusuchen und Toms Sache mit der ganzen ihr zu Gebote stehenden diplomatischen Geschicklichkeit vorzubringen.
Sie fand Marie der Länge nach auf ihrem Ruhelager ausgestreckt, mit einem Ellbogen auf zahlreiche Kissen gestützt, während Jane, die Besorgungen gemacht hatte, Proben von dünnen, schwarzen Stoffen vor ihr ausbreitete.
»Ich habe nicht ein einziges Kleid, das ich anziehen könnte, und wenn ich jetzt den Haushalt auflöse und nächste Woche aufbreche, muß ich mich entscheiden«, sagte Marie.
»Gehen Sie schon so bald?«
»Ja, St. Clares Bruder hat geschrieben, er und der Anwalt sind der Ansicht, Möbel und Sklaven am besten auf der Auktion zu versteigern und das Haus in die Obhut des Anwalts zu geben.«
»Über eins hätte ich mich noch gern mit Ihnen besprochen«, sagte Miß Ophelia. »Augustin hatte Tom die Freiheit versprochen und schon die ersten gesetzlichen Schritte dazu unternommen. Ich hoffe sehr, Sie werden Ihren Einfluß geltend machen, damit die Sache in Ordnung kommt.«
»Ich werde mich hüten!« rief Marie scharf. »Tom ist einer der wertvollsten Sklaven des ganzen Besitztums; ihn zu entbehren kann ich mir einfach nicht leisten. Außerdem, was will er mit der Freiheit? So geht es ihm doch viel besser.«
»Aber er erstrebt sie mit aller Kraft, und sein Herr hat sie ihm versprochen«, entgegnete Miß Ophelia.
»Ich kann mir denken, daß er danach strebt. Aber man tut ihnen keinen Gefallen, wenn man sie freigibt.«
»Aber Tom ist fleißig, fromm und rechtschaffen.«
»Oh, das brauchen Sie mir nicht zu versichern! Ich kenne seinen Fall, auch er benimmt sich nur gut, solange man ihn beaufsichtigt, weiter steckt da nichts dahinter.«
»Aber bedenken Sie doch«, sagte Miß Ophelia, »wenn Sie ihn verkaufen, wie leicht kann er einem schlechten Herren in die Hände fallen.«
»Ach, das ist doch alles Lug und Trug. In hundert Fällen gibt es nicht einen, daß ein guter Sklave einen schlechten Herrn erhält; die meisten Herren sind gut, trotz allen Geredes. Ich bin hier im Süden aufgewachsen und habe unter meinen Bekannten nicht einen Herrn gekannt, der seine Sklaven nicht gut behandelt, auf jeden Fall nicht schlechter, als sie es verdienen. In dieser Hinsicht mache ich mir keine Sorgen.«
»Ja, aber«, sagte Miß Ophelia mit Nachdruck, »es war schließlich einer der letzten Wünsche Ihres Mannes, daß Tom seine Freiheit erhalten sollte; er hat es unserer lieben Eva auf dem Totenbett versprochen, ich dächte, Sie werden sich nicht berechtigt fühlen, dies zu ignorieren.«
Bei diesen Worten bedeckte Marie ihr Gesicht mit dem Taschentuch und fing leidenschaftlich an zu schluchzen und ihr Riechfläschchen zu benutzen.
»Alle sind sie gegen mich«, klagte sie. »Alle sind sie rücksichtslos! Von Ihnen hätte ich das nicht gedacht, daß Sie diese Erinnerungen heraufbeschwören, das ist so roh! Niemand bedenkt, wie ich betroffen bin. Es ist ein solch schwerer Schlag, daß mir mein einziges Kind genommen wurde und daß ich meinen Mann, mit dem ich mich so gut verstand — und wie schwer ist das bei mir! — , hergeben mußte. Sie haben wirklich wenig Mitgefühl und reden so leichtfertig von meinem Verlust — wo Sie doch wissen, wie ich leide. Sie mögen es gut meinen; aber es ist doch rücksichtslos!« Und Marie schluchzte, rang nach Atem und rief Mammy, daß sie das Fenster öffne, ihr das Kampferfläschchen bringe, den Kopf kühle und das Kleid aufhake; in der allgemein entstehenden Unruhe floh Miß Ophelia auf ihr Zimmer.
Sie sah ein, daß es keinen Zweck hatte, noch weiter in Marie zu dringen, denn Maries Fähigkeit, hysterische Anfälle in Szene zu setzen, war unerschöpflich. Jedesmal, wenn seither auf die Wünsche ihres Mannes oder Evas hinsichtlich der Dienerschaft angespielt wurde, hatte sie einen solchen zur Hand. Miß Ophelia griff daher zu einem zweiten Mittel, um Tom zu helfen; sie schrieb für ihn an Mrs. Shelby, schilderte seine Lage und drängte sie, ihm zu Hilfe zu kommen.
Am nächsten Tag wurden Tom und Adolf und ein halbes Dutzend andere zum Sklavenspeicher getrieben, um dort abzuwarten, bis der Händler geneigt war, einen Schub für die Auktion abzufertigen.
29. Kapitel
Der Sklavenspeicher
Ein Sklavenspeicher! Vielleicht verbinden einige Leser schreckliche Vorstellungen mit einem solchen Ort. Sie malen sich eine dunkle, unsaubere Scheune aus. Weit gefehlt, liebe Unschuld! Heutzutage sündigt man gefällig und manierlich. Menschenware steht hoch im Kurs und wird daher gut ernährt, reinlich gehalten, gepflegt und gestriegelt, damit sie glatt, blank und kräftig auf den Markt kommt. Ein Sklavenspeicher in New Orleans ist ein Haus, äußerlich fast wie viele andere.
Man wird dich höflich auffordern, einzutreten und die Ware in Augenschein zu nehmen; drinnen werden sich Ehemänner, Ehefrauen, Geschwister, Eltern und kleine Kinder im Überfluß finden, die >einzeln oder gemeinschaftlich, ganz nach Belieben des Käufers< zum Verkauf gelangen. Dort kann jede unsterbliche Seele, die einst Gottes Sohn mit Blut und Tränen kaufte, als die Erde bebte, Berge hinfielen und die Gräber sich öffneten, verkauft, verpachtet, verpfändet oder gegen Kolonialwaren eingetauscht werden, ganz wie es den Handelsformen entspricht.
Wenige Tage nach der Unterhaltung zwischen Marie und Miß Ophelia übergab man Tom, Adolf und noch einige andere aus St. Clares Haushalt der liebevollen Obhut Mr. Skeggs', der den Sklavenspeicher in der X–Straße leitete, damit sie am nächsten Tage versteigert würden.
Читать дальше