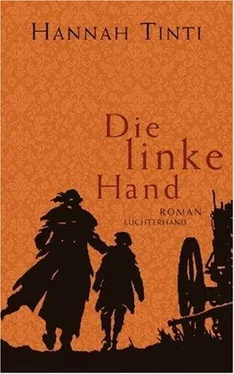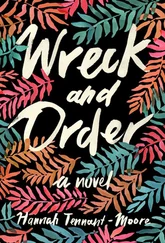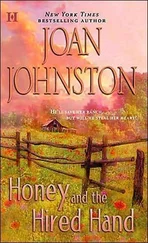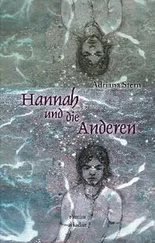Hinter dem Korb kam die Ordensschwester mit dem Bein des Mannes. Es war in ein Leintuch gehüllt, und sie wiegte es in ihren Armen wie ein Baby. Während sie vorbeiging, tropfte Blut in einem stetigen Rinnsal aus dem Bündel und hinterließ feine Linien auf ihrer Schürze.
Ren ließ sich wieder auf die Bank sinken. Seine Kehle war trocken. Seine Narbe juckte.
»Ich habe ihm gesagt, dass du da bist.« Das sagte die Nonne, ohne stehen zu bleiben, den Kopf zu drehen oder das Bein loszulassen. Dann folgte sie dem Korb die Treppe hinunter.
Eine Schar junger Ärzte mit Büchern und Aufzeichnungen unter dem Arm strömte in den Korridor. Sie trugen Anzüge mit Westen und dazu passenden Überziehern, Manschettenknöpfe und Taschenuhren und glänzende Schuhe. Einer öffnete eine kleine Silberdose und entnahm ihr mit zwei Fingern eine Prise Schnupftabak. Ein anderer setzte seine goldgeränderte Brille ab und putzte sie mit einem Stück Ziegenleder. Ein paar sahen Ren im Vorbeigehen an, und plötzlich fühlte er sich in den Kleidern des ertrunkenen Jungen unbehaglich. Einige verschwanden am Ende des Ganges, und andere gingen die Treppe hinunter auf die Station. Dann war der Flur leer, und es kehrte wieder Ruhe ein.
»Junge!«, rief eine Stimme aus dem Raum am Ende des Flurs.
Ren stand auf. Er legte die Hand aufs Treppengeländer. Am liebsten wäre er hinuntergelaufen, aber der Gedanke an Benjamins enttäuschte Miene hielt ihn zurück. Er ging ein paar Schritte auf die Stimme zu, dann folgte er der schmalen Blutspur in den Raum, aus dem zuvor alle gekommen waren.
Als er eintrat, war er erstaunt über die Lichtfülle. In die Decke waren Fenster eingelassen; man hatte das Dach abgedeckt und durch dicke Glasscheiben ersetzt. Der Raum war für eine größere Anzahl Menschen gedacht. Bänke umgaben ein großes Podest in der Mitte, und auf diesem Podest stand der Mann von dem Porträt im Flur an einem Tisch und wischte mit einem Wachstuch eine Knochensäge ab.
Er sah etwas anders aus als auf dem Gemälde. Ren stellte fest, dass er älter war. Seine Augenbrauen waren buschig. Sein Haar war dicht und grau. Aber die Stirn von Doktor Milton war unverkennbar – stark gewölbt und eigentümlich geformt –, und sein Gesichtsausdruck verriet denselben Hunger auf Würste wie bei dem Mann auf der Leinwand, als er jetzt auf das Wachstuch spuckte und einen getrockneten Blutfleck weg rieb.
»Von jetzt an kommst du um zehn. Einmal die Woche. Ein regelmäßiger Termin.« Der Anzug des Arztes war makellos sauber. Lediglich an einem Ärmel hatte er einen Fleck in Form eines Schmetterlings. Doktor Milton wischte die Säge ab und legte sie dann behutsam auf den Tisch. »Komm her.«
Ren ging durch die Bankreihen nach unten und stieg auf das Podest. Doktor Milton betrachtete ihn von oben bis unten, dann hob er ihn auf die Kante des Operationstisches. Ren empfand ein seltsames Schwindelgefühl, so als balancierte er auf einer Felskante, und umklammerte den Rand des Tisches. Er war voller Sägemehl, das an seinen Fingern kleben blieb.
Der Arzt beugte sich zu ihm hinunter. Sein Bart roch nach Tabak. »Deine Aufgabe wird darin bestehen, zu tun, was ich dir sage. Und zwar haargenau. Glaubst du, das bringst du fertig?«
Ren nickte.
»Braver Junge.« Doktor Milton ergriff ein Messer. »Siehst du das hakenförmige Ende? Das dient dazu, dass man leichter um die Venen herumschneiden kann.« Er wischte die Klinge mit dem Tuch ab und gab sie dann Ren. »Leg es zurück«, sagte er.
Das Messer hatte ein angenehmes, solides Gewicht. Auf der anderen Seite des Operationstisches stand ein offenes Holzschränkchen mit den unterschiedlichsten silbern glänzenden Instrumenten. Zwei eingebaute Besteckschubladen waren herausgenommen worden und lagen links davon. Jedes Instrument hatte seinen festen Platz. In dem grünen Baumwollsamt waren Mulden, mehrere Dutzend leere Plätze. Ren spürte, wie seine Handfläche feucht wurde und der Handgriff durch seine Finger glitt. Endlich sah er, wo das Messer hingehörte – in eine der Schubladen unter die Knochensäge. Dort war der Samt vom Haken an der Spitze abgewetzt.
Er legte es hinein, und Doktor Milton schien zufrieden. Er ließ seinen Blick über den Jungen wandern, und als er an der Narbe innehielt, stieß er einen erstaunten Seufzer aus. Der Arzt untersuchte den Arm, bewegte ihn hin und her. »Der Schnitt ist plump, aber die Arterien wurden frühzeitig abgeklemmt. Wer immer das gemacht hat, wusste genau, was er tat. Du hast Glück gehabt, mein Junge. Sag es.«
»Ich hatte Glück.«
Doktor Milton klemmte ein Stück Haut zwischen zwei Finger. »Meine Ausbildung hat mit Amputationen begonnen. Ich bin immer neugierig, wie sich die Haut in diesen Fällen regeneriert.« Er nahm ein kleines Skalpell aus dem Instrumentenschrank. »Hast du was dagegen, wenn ich eine Probe nehme?«
Noch ehe Ren antworten konnte, tunkte der Arzt ein Stück Stoff in Wasser und säuberte Rens Armstumpf. »Du wirst nur ein leichtes Ziepen spüren.« Und während er das sagte, schnitt er auch schon. Das Messer fuhr durch die Narbe und hobelte ein hauchdünnes Scheibchen Gewebe ab. Es ging so schnell, dass Ren erst merkte, was geschah, als die Haut bereits weggeschnitten war.
Er legte seine Hand auf den Schnitt. Er war nicht tief, aber er tat weh. Mit einer Pinzette nahm Doktor Milton das Hautfetzchen und legte es in eine kleine Glasschale, dann trug er die Hautprobe hinüber zu einem Mikroskop, wie ein Stückchen Rinde, das er soeben von einem Baum geschält hatte. Er legte ein Auge ans Mikroskop und regulierte die Drehknöpfe.
»Normale Haut sieht aus wie Schuppen«, sagte Doktor Milton. »Regelmäßige, einander überlappende Teilchen. Aber Narbengewebe ist anders. Es enthält keine Haarfollikel und keine Schweißdrüsen.« Er winkte Ren zu sich heran und trat beiseite, damit der Junge es sich ansehen konnte.
Ren, der noch immer seinen Armstumpf hielt, beugte sich vor. Anfangs konnte er gar nichts erkennen. Nur etwas Licht. Von der Vergrößerung wurde ihm schwindelig. Dann rückte das Bild in den Fokus. Das Narbengewebe war auf einer Seite glatt, doch Ren sah, dass es sich darunter in ein Muster aus feinen Linien auffächerte, wie Frost auf einer Fensterscheibe.
»Dieselbe Art von Maserung habe ich an inneren Organen beobachtet. Am Herzen und an der Leber. Und sie zieht sich durch die ganze Muskulatur. Unter den richtigen Voraussetzungen kann sich Narbengewebe ausbreiten.« Wieder ergriff Doktor Milton Rens Arm und tupfte etwas Flüssigkeit aus einer braunen Flasche auf die Stelle, an der er geschnitten hatte. »Hast du schon mal in einen Körper hineingeschaut?«
»Nein.«
»Es sieht wunderschön aus.« Doktor Milton drückte zwei Finger in Rens Arm oberhalb des Ellbogens. »Vor allem die Muskeln direkt am Knochen. Flexor longus pollicis « – er drückte auf der rechten Seite –, »Flexor profundus digitorum« – er fuhr mit den Fingern die Vorderseite des Arms hinunter – »und Pronator quadratus , der normalerweise irgendwo hier wäre«, er klopfte seitlich an Rens Stumpf. »Du hättest bestimmt nicht gedacht, dass so viel in dir drin ist, was, mein Junge?« Doktor Milton nahm das Stück Narbengewebe aus dem Mikroskop und ließ es in ein Glasgefäß fallen, das er mit einem Deckel verschloss. Er fragte Ren nach seinem Namen und schrieb ihn auf ein Etikett auf der Rückseite.
»Wonach hat es für dich ausgesehen, unter dem Mikroskop?«
Ren überlegte kurz. »Nach alten Spinnweben.«
Der Arzt stellte das Gefäß ab. Er betrachtete Ren mit frischem Interesse. Er holte ein Notizbuch hervor und schrieb rasch hinein, was der Junge gesagt hatte. Dann steckte er das Büchlein wieder sorgfältig in die Tasche. »Mein Freund Mister Bowers behauptet, dass man dir und deinen Freunden trauen kann. Meinst du, ich soll ihm glauben?«
Читать дальше