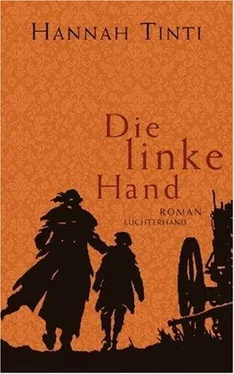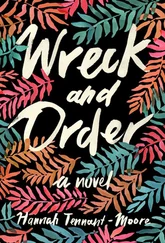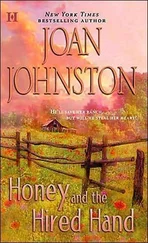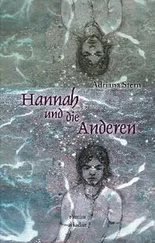Ren rückte so dicht an Benjamin heran, wie es nur ging. Er kauerte sich zusammen und hielt sich seitlich am Wagen fest. Er zählte die gesamte Wagenladung. Drei Leichen, zwei Diebe, ein toter Mann und er. Das Pferd zog sie alle, und seine Hufe hallten auf der steinigen Straße.
Benjamin saß auf dem Rand des Karrens, alle zehn Finger in den Haaren. In regelmäßigen Abständen holte er aus und schlug dem toten Mann kräftig ins Gesicht.
»He du«, sagte er. »Immer noch unter uns?« Als Antwort kam aus dem Anzug ein leises Gurgeln. »Sieht ganz danach aus«, sagte Benjamin. »Und vermutlich wirst du uns erhalten bleiben.«
Tom und Benjamin hatten alle Mühe, den Mann die Treppe hinaufzutragen. Ren ging voraus und hielt die Laterne, sperrte Schlösser auf und öffnete Türen, ermahnte sie, einen Augenblick still zu sein, bis er sich vergewissert hatte, dass sich Mrs. Sands nicht in der Küche aufhielt. Es war kurz vor vier, die letzten eisigen Atemzüge der Nacht vor dem Morgen. Der tote Mann schnarchte noch immer leise vor sich hin, als sie ihn auf das Bett wuchteten.
»Was sollen wir mit ihm machen?«, fragte Tom. »Hierlassen können wir ihn nicht.«
»Vorerst schon«, sagte Benjamin. »Wir haben keine andere Wahl.« Er griff hinten in den Hosenbund, zog den Revolver heraus und gab ihn Ren.
»Pass auf ihn auf«, sagte er. Dann blies er das Licht aus.
Es dauerte ein paar Minuten, bis Rens Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Er lauschte den Schritten der Männer, als sie die Treppe hinuntergingen, dann schob er den Vorhang beiseite, um sie wegfahren zu sehen. Hinten im Wagen konnte er Tom erkennen. Nun hielt Benjamin die Zügel, und an der Art, wie er dasaß und sich vorbeugte, erkannte Ren, dass er sich Sorgen machte. Wenn es ihnen nicht gelang, die toten Leiber vor Tagesanbruch ins Krankenhaus zu schaffen, stünden sie mit einem Wagen voller Leichen da.
Ren stand allein im Dunkeln und dachte an die Hinterbliebenen, die kommen würden, um an den leeren Särgen zu beten, die sie hinterlassen hatten. Der violette Anzug hinter ihm schnarchte. Es war ein sattes, feuchtes Geräusch, das mit jedem Einatmen anschwoll, bis der tote Mann nicht nur das ganze Bett einzunehmen schien, sondern den halben Raum bis hinauf zur Decke. Ren hockte sich auf Toms Matratze und legte den Revolver auf sein Knie. Er fuhr mit dem Finger über den Schlagbolzen. Das Metall war kalt. Wenn er den Abzug drückte, würde die Patrone direkt in das Herz des Mannes gehen. Das wäre dann garantiert sein Ende. Aber Ren hoffte, es möge nicht dazu kommen. Was sollte er Mrs. Sands sagen, wenn sie hereinkam und sah, dass er jemanden getötet hatte? Sie hielt ihn für einen guten Jungen, und er wollte nicht, dass sie die Wahrheit erfuhr.
Ren ging an die Tür und horchte. Im Haus war es still. Mrs. Sands schlief noch, ohne etwas von dem Fremden zu ahnen, den sie unter ihrem Dach beherbergte. Erleichtert kehrte Ren wieder auf seinen Platz zurück. Eine kleine Spinne kroch über den Bauch des toten Mannes, blieb kurz stehen und hastete dann weiter. Wahrscheinlich hatte der tote Mann eine Menge Ungeziefer, und jetzt waren die Tierchen bestimmt alle in seinem Bett.
Der Mund des Mannes stand offen, seine Zähne schimmerten im Mondlicht. Ren fragte sich, wie es dazu gekommen war, dass er lebendig begraben wurde – ob einem Arzt sein Pulsschlag entgangen war oder ob er selbst einen Weg gefunden hatte, seine Seele aus dem Himmel zurückzuholen. Es war nicht so wie im Leben der Heiligen, wo der heilige Antonius ein Kind auferweckt hatte, um den Namen seines Vaters reinzuwaschen. Das hier war ganz und gar nicht heilig. Ren beugte sich über die Decke und schnippte die Spinne mit Daumen und Zeigefinger weg. Sie landete auf dem Boden, und Ren trat rasch darauf und zerquetschte sie auf den Holzdielen. Als er aufblickte, sah er, dass der tote Mann wach war.
Ren hob den Revolver. Wenn er ihn frei in der Luft hielt, war er so schwer, dass seine Hand ein wenig zitterte.
Der Mann blinzelte. Sein Bauch hing über den Bettrand. Die Hände hatte er seitlich unter den Kopf geschoben, so als sei er es gewohnt, ohne Kissen auszukommen. Jetzt wirkte er sogar noch größer, und Ren kam es vor, als könnte der Mann ihn ebenso mühelos zertreten wie eine Spinne. Rens rechter Arm wurde bereits müde, und so stützte er ihn mit dem linken, mit dem Knubbel unterhalb des Handgelenks, ab.
»Sieht aus, als würdest du tanzen«, sagte der Mann. Er hob beide Hände und wischte sich etwas vom Gesicht. Ren sah ein kleines Insekt auf den Boden fallen. Es hatte viele Beinchen, mit denen es jetzt auf den Fuß des Jungen zukrabbelte. Ren hob den Fuß, ließ ihn wieder sinken und drehte dabei die Schuhspitze hin und her.
»Du machst es schon wieder«, sagte der Mann. »Aber wo ist die Musik?« Seine Stimme war tief und kratzig, als hätte er seit Jahren nicht mehr gesprochen. Ein Kribbeln kroch hinten an Rens Beinen hoch. Es kam ihm vor, als wäre der Mann nicht nur einen Tag begraben gewesen, sondern ein ganzes Jahrhundert. Im Zimmer war es dunkel, aber aus seinem Körper schien noch mehr Dunkelheit zu sickern, wie ein dichter, bösartiger Nebel. Er schloss einen Moment lang die Augen. »Mich friert.«
Ren klemmte den Revolver unter den Arm und warf mit zitternden Händen eine von Mrs. Sands’ Steppdecken über das Bett.
»Was für eine Wohltat«, sagte der Mann. Dann schwieg er eine Weile, und Ren dachte schon, er sei vielleicht wieder eingeschlafen. Er ließ den Revolver sinken und hielt nach Ungeziefer Ausschau. Da merkte er, dass der Mann weinte.
Ren hatte immer gedacht, dass Menschen, wenn sie älter werden, nicht mehr weinen. Als er den Mann jetzt schluchzen hörte, hatte er das Gefühl, dass man wohl nie damit aufhörte. Das ganze Bett bebte. Der violette Anzug wogte auf und ab. Aus der Brust des Mannes drang ein tiefer Seufzer, ein so abgrundtiefes Stöhnen, dass er sich unwillkürlich zusammenkrümmte. Ren kannte dieses Schluchzen aus dem Schlafsaal der kleinen Jungen. Man hörte es in den schlimmen Nächten, wenn die Kinder an ihre Mütter dachten.
Ren setzte sich auf die Bettkante. Jetzt roch er den Nebel, so dicht und widerlich, dass er beinahe zu schmecken war. Durch die Decke hindurch berührte er den Fußknöchel des Mannes und spürte, wie er sich unter seiner Hand wölbte. Ren tätschelte den Fuß. Er saß da und tätschelte hebevoll den Fuß, bis sich der Mann schließlich beruhigte.
Die Stille, die daraufhin eintrat, war nervenzerreißend. Der Mann wischte sich weder Augen noch Nase ab. Er ließ es laufen, bis die feuchten Bächlein auf seinem Gesicht trockneten. Es war, als hätte er noch nie im Leben geweint. Er holte tief Luft, und als er ausatmete, fiepten seine Nasenlöcher leise. Dann hustete er.
»Ich hab Durst.«
Draußen im Flur entdeckte Ren eine Schüssel und füllte sie am Waschtisch mit Wasser. Dann steckte er den Revolver in die Tasche und trug die Schüssel ins Zimmer. Als er die Tür aufmachte, saß der Mann aufrecht im Bett. Er hatte sich offenbar mühelos von seinen Fesseln befreit und das Jackett ausgezogen. Er hatte klobige Schultern und einen massigen Körper, und der Bauch unter seiner breiten, behaarten Brust hing herunter. Seine Stirn lag in Falten, als versuchte er angestrengt, sich an etwas zu erinnern.
»Was ist mit den anderen?«
»Die sind bald wieder da«, sagte Ren. Er hielt ihm die Schüssel mit Wasser hin, und der Mann griff danach.
Seine Hände waren riesig, dreimal so groß wie die von Ren, die Handflächen schwielig und muskulös, die Finger kurz und dick. Er trank in großen Schlucken, wobei sein blau verfärbter Hals lautlos pulsierte. Als er die Schüssel ausgetrunken hatte, setzte er sie am Boden ab. »Wer bist du?«, fragte er.
»Ich bin Ren.«
»Ich bin Dolly.« Er beäugte den Revolver, und Ren sah ihm an, dass er überlegte, ob er ihn an sich bringen sollte oder nicht. »Wirst du mich erschießen?«
Читать дальше