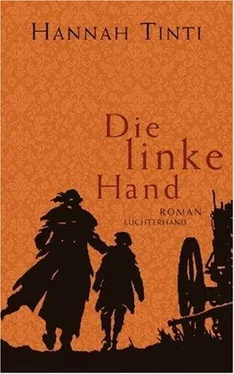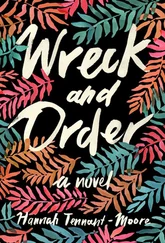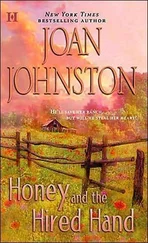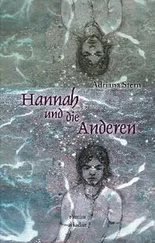»Wo seid Ihr zu Hause, Mister Nab?«
»Ich habe den größten Teil meines Lebens auf See verbracht. Erst auf einem Handelsschiff, das nach Ostindien gesegelt ist, und später dann auf Walfängern. Hätte ich nicht von der Krankheit meiner Schwester erfahren, wäre ich noch immer draußen auf dem Meer.«
»Das ist eine gefährliche Arbeit.«
Benjamin schlürfte seinen Kaffee. »Und einsam.«
Tom verdrehte die Augen.
»Und Euer Freund?«
»Ohne Arbeit«, sagte Tom.
»Er ist Lehrer«, sagte Benjamin.
»Ein schöner Lehrer.«
Tom stand auf. »Wie meint Ihr das?«
Doch da Mrs. Sands ihm den Rücken zukehrte und ihn nicht hören konnte, redete sie weiter. »Ein Lehrer sollte wissen, dass ein Kind so spät abends nichts mehr auf der Straße verloren hat. Ein Lehrer sollte wissen, dass man einen Jungen nicht in Lumpen herumlaufen lässt.«
»Ich will Euch mal was sagen«, sagte Tom, brachte den Satz aber nicht zu Ende. Er sah erst die Hauswirtin an, dann sein halb aufgegessenes Abendessen und erklärte schließlich: »Ich gehe ins Bett.« Er schnappte sich seinen Teller, legte noch zwei Scheiben Schinken und Brot darauf und stapfte die Treppe hinauf.
»Ihr müsst ihm verzeihen«, sagte Benjamin. »Früher war er mal in meine Schwester verliebt.«
»Sehr klug von ihr, ihn nicht zu heiraten.«
»Wahrscheinlich schon«, sagte Benjamin; er wirkte nachdenklich und ein wenig betrübt. Er kramte in seinen Taschen, bis er seine Pfeife fand, und zog einen Holzspan aus dem Feuer, um sie anzuzünden. Dann klaubte er eine Kartoffel aus dem Korb und holte sein Bärenmesser hervor. Er fing an zu schälen, und zusammen mit Mrs. Sands schälte er weiter, ohne zu reden.
Ren fror und hätte gern noch ein Stück Brot gehabt, hatte aber Angst, das Schweigen zu brechen oder ohne Mrs. Sands’ Erlaubnis aus dem Bottich zu steigen. Seine Zehen wurden allmählich schrumpelig. Die eine Seite des Bottichs war dem Feuer zugewandt und deshalb wärmer, und er lehnte sich dagegen.
Mrs. Sands betrachtete Benjamins Gesicht. Im Feuerschein, mit aufgeknöpftem Hemdkragen und zurückgestrichenem Haar sah er jünger aus, als er war. Als die Kartoffel, die er gerade in der Hand hatte, fertig geschält war, lehnte er sich zurück und zog kräftig an seiner Pfeife. Der Rauch roch nach Zucker. Ren atmete ihn tief ein. Dann sah er, wie Benjamin eine Falte von Mrs. Sands’ braunem Kleid anhob und seine Finger auf ihr Knie schob. Mit der anderen Hand rauchte er weiterhin seine Pfeife, und Mrs. Sands wandte sich wieder ihrer Kartoffel zu und schnitt sorgfältig die Schale ab. Eine leichte Röte überzog ihre Wangen.
Ren legte das Kinn auf den Rand des Bottichs. Das Feuer verlosch allmählich. Die Holzscheite waren von der Mitte aus zu schwarzer Asche zerfallen. Die Kleider des Jungen waren verbrannt. Nur noch ein paar Stofffetzchen schwelten unter dem Rost. Er betrachtete sie, bis er es nicht mehr ertragen konnte, dann hielt er die Luft an und tauchte unter. Kaum war er unter Wasser, klopfte es von außen an den Bottich. Blinzelnd streckte er den Kopf aus dem Badewasser. Benjamin hatte noch immer eine Hand unter Mrs. Sands’ Röcken, aber er zwinkerte Ren zu und deutete mit dem Kopf zur Tür.
»Ich muss hier raus«, sagte Ren. Mrs. Sands sah ihn eigenartig an. Sie schloss die Augen, und auf einmal hatte Benjamin wieder zwei freie Hände, mit denen er seine Stiefel aufhob.
Mrs. Sands legte ihr Messer beiseite und stand auf. Mit einem energischen Ruck hob sie Ren auf die Anrichte und nibbelte ihm mit einem kleinen Handtuch den Nacken, als wäre sie böse auf ihn. Die kalte Luft traf ihn unvorbereitet. Er bekam eine Gänsehaut und klapperte mit den Zähnen, bis Mrs. Sands schrie: »Halt still! «
»Ihr solltet nett zu ihm sein«, sagte Benjamin, »sonst sucht uns noch der Geist meiner Schwester heim.«
Mrs. Sands klatschte das Handtuch noch einmal auf Rens Rücken, als wollte sie klarstellen, dass sie sich von Gespenstern keine Angst einjagen ließ. Dann zog sie ihm ein wollenes Unterhemd über den Kopf und steckte ihn in die Kleidungsstücke, die die Männer heruntergebracht hatten.
Er war kleiner als der ertrunkene Junge. Die Hose reichte ihm bis über die Zehen, und seine Arme verschwanden in den Ärmeln. Mrs. Sands krempelte die Ärmelaufschläge hoch, nahm mit den Fingern Maß am Kragen, und riss ihm dann die Sachen wieder vom Leib. Sie stülpte ihm ein Nachtgewand über den Kopf, das eher eine Art Decke war – ein kratziger Stoff, Knöpfe bis zum Hals und so lang, dass der Saum hinter ihm herschleifte. Dann nahm sie Ren auf den Arm wie ein kleines Kind und trug ihn die Treppe hinauf.
»Da wären wir«, sagte Mrs. Sands und stieß mit dem Fuß eine Tür auf. Es war ein kleines Zimmer, mit zwei in die Ecken geschobenen Betten. In einem schnarchte Tom bereits, und auf das andere ließ Mrs. Sands jetzt Ren fallen. In Saint Anthony hatte er sich oft vorgestellt, dass eine Mutter ihn abends zu Bett bringt. Aber das war ganz anders gewesen. In seiner Phantasie sprach die Mutter leise und war wunderschön. Sie strich ihm übers Haar und gab ihm einen sanften Kuss auf die Wange. Mrs.
Sands schlug auf die Kissen ein, als hätten sie ihr etwas angetan, und deckte Ren so fest zu, dass er kaum noch Luft bekam.
»Also, kannst du ein Gebet oder nicht?«, schrie sie ihn an.
Beten konnte er sehr wohl. Ren ratterte ein Rosenkranzgesätz herunter und einen Segenswunsch für Mrs. Sands, weil sie ihnen Unterschlupf gewährt hatte, und außerdem für seine Eltern, die angeblich am Fieber gestorben waren, und für seinen neu entdeckten »Onkel« Benjamin. Mrs. Sands schien zufrieden, wenngleich Ren auffiel, dass sie nicht mit betete.
»Habt Ihr Kinder?«, fragte Ren.
»Großer Gott, nein! Wozu brauche ich ein Kind?«
»Aber Eure Freundin hat Euch doch die Kleider des ertrunkenen Jungen geschickt.«
»Ja, das hat sie.« Mrs. Sands blickte aus dem Fenster. Auf einmal wirkte sie erschöpft.
Ren kuschelte sich unter die Decke. Er merkte, dass er etwas Falsches gesagt hatte. »Vielleicht wäret Ihr eine gute Mutter gewesen«, meinte er.
»Da bin ich nicht so sicher.« Ihre Hände flogen nach oben. Sie stopfte ein paar vorwitzige Haarsträhnen zurück unter die Haube, dann kniff sie Ren in den Arm. »Aber immerhin habe ich für diese alten Kleider eine Verwendung gefunden, nicht wahr?«
»Das stimmt«, sagte Ren und rieb sich die Stelle, an der sie ihn gekniffen hatte.
»Ich hoffe, du hast für mich mitgebetet«, sagte Benjamin. Er stand mit den Stiefeln in der Hand im Türrahmen. Er stellte sie in den Schrank und machte Anstalten, sein Hemd auszuziehen.
Mrs. Sands schien es plötzlich eilig zu haben. Sie legte den Schlüssel auf den Toilettentisch und verließ das Zimmer. Dann stürmte sie mit einem Stapel Handtücher herein und legte sie auf die Wäschekommode. Kurze Zeit später kehrte sie mit drei zusätzlichen Kissen zurück, die sie auf den Schaukelstuhl in der Ecke warf. Dann kam sie noch einmal mit einem Riesenstapel Bettlaken und Decken – gehäkelten und gestrickten und bunt gesteppten – und ließ das ganze Bettzeug auf Rens Kopf fallen.
»Gute Nacht«, schrie sie.
»Gute Nacht«, sagte Benjamin und sperrte die Tür hinter ihr zu.
»Wie lange müssen wir hierbleiben?«, fragte Ren und schob die Decken beiseite.
Benjamin streifte seine Hosenträger ab. »Bis auf weiteres.«
»Ich mag sie nicht.«
»Wirklich?«, sagte Benjamin. »Ich dachte, du bist in sie verliebt.«
»Und ich dachte, du.«
»Ich wollte sie nur ein bisschen glücklich machen.«
Ren stellte sich vor, wie es wäre, sich Abend für Abend im Bottich waschen zu müssen. Er trat gegen das Brett am Fußende, und etwas Schweres fiel zu Boden. Benjamin bückte sich und hob es auf. Es war eine Wärmflasche, aus dickem braunem Ton und mit einem Korken verstöpselt.
Читать дальше