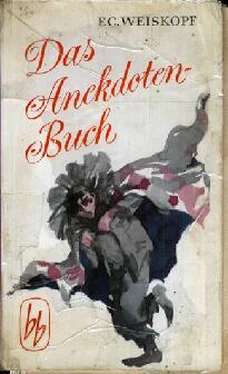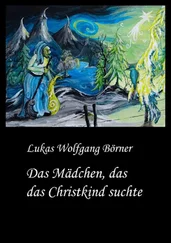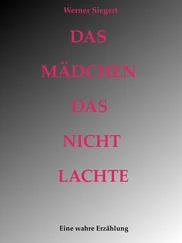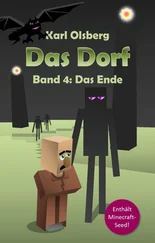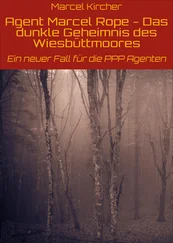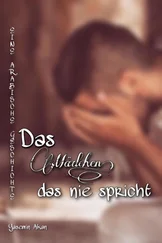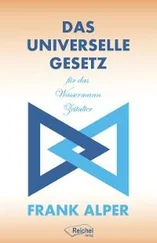" — "Verkauft?" wundere ich mich. "Wollen Sie am Ende nicht mehr nach Amerika zurück?" — "In der Tat", versetzt er, "ich will in China bleiben", und bestellt noch eine Milch mit Coca-Cola und Rum. "Da erwartet man Sie wohl schon?" vermute ich. "I wo denn", entgegnet er, "und ich weiß überhaupt noch nicht, was ich dort tun werde." — "Das verstehe, wer will", sage ich, "Sie entschuldigen schon, doch was zum Teufel hat Sie zu einem solchen Entschluß bewogen?" — "Das will ich Ihnen erklären", meint er, "aber vorher bringen Sie mir noch eine Milch mit Coca-Cola und Rum." Ich serviere ihm das Verlangte, und er, indem er seine Medizin hinter die Binde gießt und sich danach die Lippen leckt: "Es gibt natürlich eine ganze Menge von Gründen, aber wenn ich mir's überlege, so hat einer, der Ihnen vielleicht ganz komisch vorkommen mag, den Ausschlag gegeben." — "Und der wäre?" werfe ich ein. "Ein Brief, worin es heißt, daß in Schanghai keine Stechmücken mehr sind." — "Was?" stottere ich und glaube, nicht recht gehört zu haben, "Stechmücken?" — "Jawohl", bekräftigt er, "es geht um die Stechmücken. Vielmehr darum, daß in Schanghai keine mehr sind. Man hat sie liquidiert. Li-quidiert", wiederholt er und klopft bei jeder Silbe mit dem Glas auf die Theke, "li-qui-diert!" — "Wie?" rufe ich, "und das sollte Sie bestimmt haben…?" — "Gerade das!" erwidert er, "denn sehen Sie, wenn Mao Tse-tung und die Seinen Zeit finden, sich um so etwas zu kümmern, und wenn es ihnen gelingt, eine Plage abzuschaffen, von der wir immer angenommen haben, daß sie so elementar ist wie Regen oder Blitzschlag, — was werden sie aus diesem Land China machen! Und dann", spricht er mit einem Lächeln, wie es nur diese dicken Chinesen haben, verschmitzt und auch weise, "dann habe ich mir noch gesagt: Hier in Amerika züchtet man Stechmücken und infiziert sie mit Pest oder Cholera, um sie auf Menschen loszulassen, und drüben befreit man die Menschen von den Mücken… wie kann einem da die Wahl zwischen hüben und drüben schwerfallen?" Und bevor ich mich noch auf eine Antwort besinnen kann, hat er einen Fünfdollarschein neben die leeren Gläser gelegt und ist auch schon draußen beim Clipper. So einen Kerl habe ich, auf Ehre und Gewissen, zeit meines Lebens nicht gesehen.
Das Trennende und das Gemeinsame
Der britische Außenminister Ernest Bevin, ein ehemaliger Transportarbeiter, liebte es, den heftigsten Ausfällen gegen die Sowjetunion und den Kommunismus durch Hinweise auf seine Herkunft eine besondere Würze zu geben. Als er dies einmal im Wortgefecht mit Andrej Wyschinski, dem Leiter der Sowjetdelegation in den Vereinten Nationen, tat und dabei obendrein seinem eigenen proletarischen den bürgerlichen Ursprung des Russen gegenüberstellte, wurde ihm eine Antwort zuteil, die auch heute noch — während die Reden Bevins und er selbst längst der Vergessenheit verfallen sind — wieder und wieder erzählt und belacht wird. "Der sehr ehrenwerte Sprecher für die Regierung Seiner Britischen Majestät", sagte Wyschinski mit dem sanftesten Lächeln der Welt, "tut unrecht daran, nur das zu erwähnen, was uns beide trennt. Lassen Sie mich das Gegenteil unternehmen und darauf hinweisen, daß uns, obwohl wir so verschieden von Ursprung, Charakter und Einsicht sind, dennoch eines gemeinsam ist: wir haben beide die Klasse, aus der wir kommen, verraten, ich die Bourgeoisie und Herr Bevin die Arbeiterklasse."
An das Tor einer — für die Hitlersche Wehrmacht arbeitenden — Kopenhagener Fabrik, so wußte die dänische Untergrundzeitung "Freiheit" zu berichten, wurde eines Abends im Januar 1944 laut gepocht. Der Wächter, ein Hüne von Gestalt, Mitglied der verräterischen Clausengarde, gewahrte, als er öffnete, statt der erwarteten SS-Streife einen unscheinbaren kleinen Mann in Radmantel und steifem Glockenhut.
"Guten Abend", sagte, während er einen tiefen Bückling machte, der Fremde, "entschuldigen Sie vielmals, habe ich die Ehre, mit dem Herrn Fabrikwächter zu sprechen?" "Der bin ich. Und wer sind Sie? Was wollen Sie?" "Ich?" lautete die in freundlichstem Ton gegebene Antwort. "Ich bin Patriot Jensen. Und das sind meine Freunde." Er wies über seine Schulter nach hinten, wo plötzlich acht Männer mit schußbereiten Revolvern wie aus dem Boden gewachsen dastanden.
Eine Viertelstunde später brannte die Fabrik lichterloh. "Jensen, wohlgemerkt, ist ein Gattungsname", bemerkte die Untergrundzeitung am Schluß ihres Berichtes.
Ein Partisan von Korsika wurde gefragt, wie es die notdürftig bewaffnete Armee du maquis zuwege gebracht habe, den deutsch-italienischen Besatzungstruppen schon eine Woche vor der ersten Landung alliierter Streitkräfte drei Viertel der Insel zu entreißen und sie gegen die stärksten Angriffe zu halten.
"Wie das möglich war?" versetzte der Korse und ging daran, dem Frager eine gründliche Darlegung der militärischen Operationen zu geben, unterbrach sich jedoch schon nach wenigen Sätzen: "Ach was, ich erzähle Ihnen lieber von einer Episode, die nicht nur die Ursache, sondern auch die Notwendigkeit unseres Sieges erklärt. Zu den Straßenknotenpunkten, die am heftigsten umkämpft wurden, gehörte die Ortschaft Sartegne, deren Besitz uns in die Lage versetzte, den gesamten gegnerischen Nachschub in einem wichtigen Abschnitt zu unterbinden. Die Deutschen warfen ein ganzes Bataillon gegen den Partisanentrupp von kaum hundert Mann, der sich durch einen Handstreich des Ortes bemächtigt hatte. Stundenlang folgte ein Angriff auf den andern. Mehr als die Hälfte der Verteidiger war schon kampfunfähig, und der Feind schickte sich gerade zu einem neuen Sturm an, als dem Partisanenkommandeur gemeldet wurde, daß auf der Bergstraße im Rücken seiner Stellung eine größere Abteilung italienischer Alpini im Anrücken sei. Reserven waren nicht vorhanden. Die Feuerlinie auch nur um ein paar Gewehre zu schwächen, erschien dem Kommandeur unmöglich. So sandte er den Italienern nur zwei Späher, Jungen im Alter von vierzehn und fünfzehn Jahren, entgegen. Unterwegs streckte eine verirrte Kugel den jüngeren nieder. Der Fünfzehnjährige setzte seinen Patrouillengang allein fort. Eine Pistole am Gürtel, in der Hand eine kleine Trikolore, trat er hinter einem Felsblock hervor, dem von einem höheren Offizier geführten Vortrupp der Alpini entgeger "Halt! Wohin" Die Italiener stutzten. Schließlich rief "Ist das hier Sartegne?" Ohne Zögern kam die Antwort: "Nein, Stalingrad" Die Italiener nach einigem Durchein-anderreden, legten die Waffen nieder und erklarten, für sie sei der Krieg zu Ende."
Ein verhinderter Sankt Franziskus
Für Lilly
Die Amerikaner lieben es, ihre Vereinigten Staaten das ureigene Land Gottes zu nennen, und das Wort des Herrn wird denn auch nirgendwoanders von so vielen Menschen bei so vielen Gelegenheiten im Munde geführt. Aber auf den Zungen wohnen heißt noch nicht, in den Herzen sein, wie folgende Begebenheit zeigt, die sich zur Weihnachtszeit des Jahres 1946 in New York zugetragen hat.
Ein Brooklyner Bürger mit dem Namen Jim O., der es — weniger durch Gerissenheit oder Fleiß als durch die Gabe, andere zum Lachen, Trinken und Geldausgeben zu veranlassen — in kurzer Zeit vom Schuhputzer zum Besitzer eines Ausschank- und Billardsalons gebracht hatte, war in der Christnacht eben dabei, Kasse zu machen, als er sich unversehens von dem heftigen Wunsch, hinauszugehen und zwölf Prozent seines Erlöses an die Armen und Elenden zu verteilen, übermannt fühlte. Wie er später, bei einem der zahlreichen Verhöre, denen er sich unterziehen mußte, aussagte, war ihm der Anstoß zu seinem Vorhaben beim Abzählen der Halbdollarstücke gekommen, deren sanftes Silbergeklingel in ihm die Erinnerung an eine lang vergessene Kinderlegende von Sankt Franziskus, dem Mildtätigen, geweckt hatte.
Читать дальше