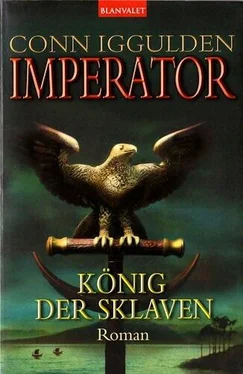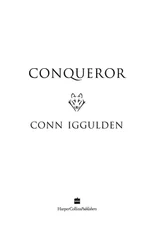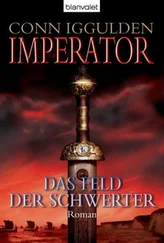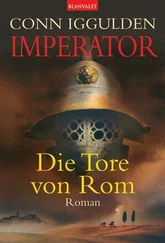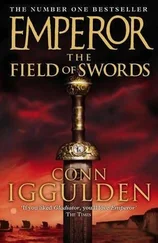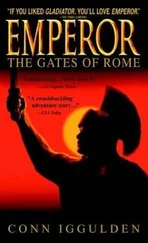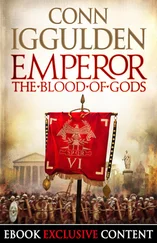»Du hast doch Ilita und deine Töchter. Oder hat sie dich mittlerweile verlassen?«, brummte Tubruk.
Fercus schnaubte in seinen Wein. »Noch nicht, aber sie droht noch immer jedes Jahr damit. Mal ehrlich, dir würde ein gutes, dralles Weib auch ganz gut tun. Die halten das Alter ganz gut von einem fern, weißt du? Und nachts wärmen sie dir auch noch die Füße.«
»Ich bin viel zu festgefahren für eine neue Liebe«, erwiderte Tubruk. »Und wo sollte ich auch eine Frau finden, die gewillt ist, es mit mir auszuhalten? Nein, ich habe auf dem Gut eine Art Familie gefunden. Eine andere kann ich mir nicht vorstellen.«
Fercus nickte, aber seinen Augen entging nichts von der Anspannung, die das Gesicht des alten Gladiators zeichnete. Er wartete geduldig, bis Tubruk bereit war, auf den Grund für seinen unerwarteten Besuch zu sprechen zu kommen. Er kannte diesen Mann gut genug, um ihn nicht zu drängen, und er war gewillt, ihm zu helfen, so gut er konnte. Obwohl er ihm viel schuldete, war es nicht nur eine Frage von Schuld. Es war mehr die Tatsache, dass er Tubruk respektierte und gern hatte. In Tubruk gab es nichts Bösartiges, und er hatte Stärken vorzuweisen, die Fercus noch in kaum einem anderen hatte entdecken können.
Im Geiste überschlug er bereits seine Besitztümer und sein verfügbares Gold. Falls es um Geld ging, so hatte es sicherlich schon bessere Zeitpunkte gegeben als gerade diesen. Aber er verfügte über einige Reserven, dazu etliche Außenstände, die er zur Not abrufen konnte.
»Wie laufen deine Geschäfte?«, erkundigte sich Tubruk, ohne zu ahnen, dass er Fercus’ Gedanken erraten hatte.
Fercus zuckte die Achseln, hielt jedoch eine vorschnelle Antwort gerade noch rechtzeitig zurück.
»Ich habe ein paar Rücklagen«, antwortete er. »Du weißt ja, dass man in Rom immer Sklaven braucht.«
Unverwandt sah Tubruk den Mann an, der ihn damals verkauft hatte, damit er für den Kampf vor Tausenden von Menschen ausgebildet wurde. Selbst damals, als er noch ein gehetzter, junger Sklave war, der nichts von der Welt oder der ihm bevorstehenden Ausbildung wusste, hatte er erkannt, dass Fercus niemals grausam gegen die Sklaven war, die er verkaufte. Tubruk erinnerte sich noch sehr gut an die schreckliche Nacht, bevor er ins Ausbildungslager gebracht werden sollte. Er war verzweifelt gewesen und hatte über Mittel und Wege nachgedacht, seinem Leben ein Ende zu setzen. Fercus war auf seiner Runde bei ihm stehen geblieben und hatte ihm gesagt, dass er sich eines Tages, wenn er Herz und Stärke besäße, freikaufen könnte, und dass dann immer noch ein Großteil seines Lebens vor ihm liegen würde.
»An diesem Tag komme ich zurück und töte dich«, hatte Tubruk zu dem anderen Mann gesagt.
Fercus hatte ihn lange und eindringlich angesehen, bevor er antwortete. »Das hoffe ich nicht«, hatte er dann gesagt. »Ich hoffe, dass du mich darum bittest, einen Becher Wein mit dir zu leeren.«
Der jüngere Tubruk hatte damals keine passende Antwort darauf gewusst, später jedoch waren diese Worte stets ein Trost für ihn gewesen. Allein der Gedanke daran, eines Tages sein eigener Herr zu sein, der die Freiheit besaß, in der Sonne zu sitzen und zu trinken, hatte ihm geholfen. An dem Tag, an dem er schließlich ein freier Mann geworden war, war er durch die ganze Stadt zu Fercus’ Haus gelaufen und hatte eine Amphore auf den Tisch gestellt. Fercus hatte zwei Becher daneben gesetzt, und so hatte ihre Freundschaft ohne jede Bitterkeit begonnen.
Wenn es außerhalb des Gutes überhaupt jemanden gab, dem er trauen konnte, dann war es Fercus. Doch er schwieg immer noch und ging im Geiste den Plan noch einmal durch, an dem er schmiedete, seit Clodia mit ihm gesprochen hatte. Gewiss gab es doch eine andere Möglichkeit. Nur mit großem Unbehagen folgte er der Richtung, die seine Überlegungen vorgaben. Aber er war bereit zu sterben, um Cornelia zu schützen, also konnte er auch genauso gut diesen Plan verfolgen.
Fercus stand auf und ergriff Tubruks Arm.
»Etwas bedrückt dich, mein alter Freund. Was auch immer es ist, frag mich.«
Als Tubruk zu ihm aufschaute, sah er ihn mit festem Blick an, in dem ihre gesamte Vergangenheit offen vor ihnen lag.
»Kann ich dir mein Leben anvertrauen?«, fragte Tubruk unvermittelt.
Anstelle einer Antwort packte Fercus seinen Arm fester, dann setzte er sich wieder auf seinen Stuhl.
»Das brauchst du nicht zu fragen. Meine Tochter lag schon fast im Sterben, bis du eine Hebamme aufgetrieben hast, die sie gerettet hat. Und wenn du damals nicht die Diebe abgewehrt hättest, wäre ich jetzt selbst tot. Ich schulde dir so viel, dass ich schon geglaubt habe, ich würde nie die Gelegenheit bekommen, dir etwas davon zu vergelten. Frage mich.«
Tubruk holte tief Luft.
»Ich will, dass du mich wieder als Sklave verkaufst. Als Sklave in Sullas Haus«, sagte er leise.
Julius spürte kaum Caberas Hand, die seine Augenlider hob. Die Welt um ihn herum war abwechselnd hell und dunkel, und sein Kopf war von einem roten Schmerz erfüllt. Er hörte Caberas Stimme von weit her und verfluchte sie innerlich, weil sie die dunkle Stille störte.
»Seine Augen stehen falsch«, sagte jemand. War das Gaditicus? Der Name bedeutete ihm nichts, doch die Stimme kannte er. War sein Vater hier? Eine vage Erinnerung daran, wie er auf dem Gut im Dunkeln gelegen hatte, stieg in ihm auf und vermischte sich mit seinen Gedanken. Lag er immer noch im Bett, nachdem Renius ihn verwundet hatte? Standen seine Freunde draußen auf den Mauern und schlugen den Sklavenaufstand zurück ohne ihn? Er bewegte sich unruhig und spürte Hände, die ihn niederhielten. Er versuchte zu sprechen, aber seine Stimme wollte ihm nicht gehorchen. Nur ein undeutlicher Laut, dem Stöhnen eines sterbenden Ochsen ähnlich, entrang sich seiner Kehle.
»Das ist kein gutes Zeichen«, hörte er jetzt wieder Caberas Stimme. »Die Pupillen sind unterschiedlich groß, und er sieht mich nicht. Sein linkes Auge ist blutunterlaufen… aber das ist in ein paar Wochen wieder vorbei. Schau nur, wie rot es ist. Kannst du mich hören, Julius? Gaius?«
Selbst auf den Namen seiner Kindheit konnte Julius nicht antworten. Eine schwarze, bleierne Schwere drängte alles weit von ihm weg.
Cabera stand auf und seufzte.
»Der Helm hat ihm das Leben gerettet, wenigstens das, aber es ist nicht gut, dass Blut aus seinen Ohren rinnt. Entweder er erholt sich irgendwann, oder aber er bleibt so wie jetzt. Ich habe so etwas schon früher bei Kopfverletzungen beobachtet. Manchmal bleibt der Verstand völlig durcheinander.« Die Traurigkeit in seiner Stimme war nicht zu überhören, und sie erinnerte Gaditicus daran, dass der Heiler zusammen mit Julius an Bord gekommen war und eine Geschichte hatte, die in eine Zeit lange vor der Accipiter zurückreichte.
»Tu für ihn, was in deiner Macht steht. Die Chancen stehen gut, dass wir alle Rom bald wiedersehen, wenn sie das geforderte Geld bekommen. Zumindest eine Zeit lang sind wir lebendig wertvoller für sie als tot.«
Es kostete Gaditicus viel Kraft, seine Stimme nicht allzu verzweifelt klingen zu lassen. Einem Kapitän, der sein Schiff verloren hatte, würde man so schnell kein anderes anvertrauen. Hilflos und gefesselt hatte er vom Deck der zweiten Trireme aus zusehen müssen, wie seine geliebte Accipiter in einem Strudel aus Luftblasen und Treibholz im Meer versank. Die Sklaven waren nicht von den Rudern losgemacht worden, und ihre verzweifelten, heiseren Schreie waren so lange zu hören, bis das Wasser ganz von dem Schiff Besitz ergriffen hatte. Er wusste, dass auch seine eigene Karriere mit der Accipiter versenkt worden war.
Der Kampf war entsetzlich gewesen. Man hatte sie in die Zange genommen, und die Piraten hatten schließlich den Großteil seiner Männer überwältigt oder getötet. Wieder und wieder ließ Gaditicus den kurzen Kampf vor seinem inneren Auge vorüberziehen, auf der Suche nach Möglichkeiten, wie er ihn hätte gewinnen können. Jedes Mal zuckte er dann irgendwann mit den Schultern und kam zu dem Schluss, dass er die Niederlage einfach anerkennen musste. Trotzdem wollte ihn die Erniedrigung nicht loslassen.
Читать дальше