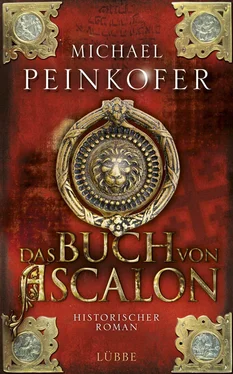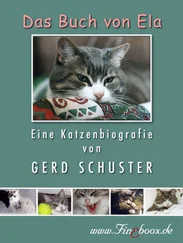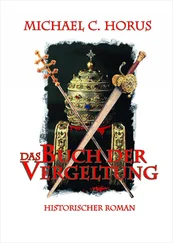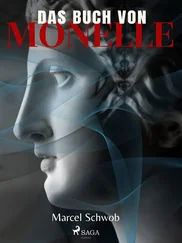Die Verblüffung war Guillaumes geröteten Zügen deutlich zu entnehmen. Natürlich wusste er, dass seine Mutter und sein Vater nur wenig füreinander übrighatten und ihre Ehe wenig mehr war als ein Zweckbündnis, das zwischen zwei mächtigen Adelsfamilien geschlossen worden war. Aber nie zuvor hatte er Eleanor derart offen und abschätzig über den Baron sprechen hören, der schließlich nicht nur ihr Gemahl war, sondern auch ihr Herr.
»Was hast du?«, fragte sie.
»Nichts, ich …«
»Du fürchtest ihn, nicht wahr?«
»Ihr etwa nicht?«
»Längst nicht mehr.« Eleanor lächelte. »Es gab eine Zeit, da habe ich meine Hoffnung in ihn gesetzt, aber das ist vorbei. Inzwischen, Guillaume, ruhen all meine Hoffnungen auf dir, und ich weiß, dass du sie nicht enttäuschen wirst.«
»Auf mir? Inwiefern, Mutter?«
»Der Tag wird kommen, da du das Erbe deines Vaters antrittst. Renald de Rein ist ein starrsinniger Narr, dem seine Ehrsucht und seine altertümliche Auffassung von Loyalität und Treue irgendwann den Untergang eintragen werden. Dann, Guillaume, schlägt deine Stunde, und es liegt in deiner und in meiner Hand, die Gunst dieser Stunde zu nutzen und dafür Sorge zu tragen, dass uns niemand nehmen kann, was unser ist. Darauf müssen wir vorbereitet sein.«
»Wie?«
»Das überlass getrost mir«, entgegnete sie rätselhaft und berührte ihn sanft am Arm. »Bis dahin tröste dich mit dem Gedanken an den Tag, der dich für alle Schmach, die du hinnehmen musstest, mehr als entschädigen wird.«
»Ach ja?« Guillaume schürzte die schmalen Lippen. Was seine Mutter da sagte, gefiel ihm durchaus. Aber in Anbetracht der jüngsten Kränkung brachten ihre Worte keinen Trost. »Und wann wird dieser glückliche Tag anbrechen? Wann werde ich mich nicht mehr als einen törichten Gecken beschimpfen lassen müssen?«
»Deine Zeit wird kommen«, versuchte Eleanor ihn zu beschwichtigen. »Vielleicht schon sehr bald …«
»… oder niemals«, vervollständigte er bitter, schob ihre Hand weg und erhob sich. »Ich ertrage das nicht länger«, sprach er und stürzte dann zum Tor, das aus der Halle führte.
Eleanor schaute ihm nach, und ihr war klar, dass sich etwas ändern musste, wann immer sich auch die Gelegenheit dazu ergab.
Guillaume hatte das Gefühl zu ersticken, wenn er nicht sofort frische Luft bekam. Wütend stieß er die Tür der Halle auf und betrat den Hof. Sein Atem ging keuchend.
Es war dunkler, als er erwartet hatte.
Die Wolken, die den Abend über herangezogen waren, hatten sich zu einer Masse verdichtet, die sich als düstere, von violetten Tälern und blaugrauen Gebirgen durchzogene Himmelslandschaft über den Zinnen der Burg erstreckte. Und wohin man auch blickte, durchzuckten Blitze die hereinbrechende Nacht, die sowohl die Wolkengebilde als auch den Innenhof der Burg flackernd beleuchteten. Donner war von fern zu hören, ein dumpfes Rumoren, das die Luft erbeben ließ.
Vom obersten Absatz der hölzernen Treppe aus, die vom Tor des Donjon in den Hof hinabführte, schaute Guillaume den Stallknechten und Mägden zu, die geschäftig umhereilten, um das Vieh und all das in Sicherheit zu bringen, was bei dem zu erwartenden Wolkenbruch trocken bleiben sollte.
Als der nächste Donner erklang, war er bereits bedeutend näher. Von Blitzen begleitet, zog das Unwetter heran und mit ihm die Erkenntnis, dass es eine unruhige Nacht werden würde. Spannung lag spürbar in der von Mückenschwärmen durchsetzten Luft und spiegelte Guillaumes inneren Aufruhr in mancher Weise wider. Er versuchte sich vorzustellen, dass das nahende Gewitter nicht nur eine weitere Laune des wankelmütigen englischen Wetters wäre, sondern ein Wink des Schicksals, ein Vorzeichen dafür, dass etwas Großes, etwas Unvorhersehbares geschehen würde. Etwas, das seinem langweiligen, von stumpfsinnigen Regeln beherrschten Leben eine Wendung geben und ihm die Bedeutung verleihen würde, die ihm von Rechts wegen zukam.
Der Gedanke gefiel ihm, und er verfolgte ihn weiter, gab sich Ideen und Vorstellungen hin, für die sein Vater ihn wenn nicht erschlagen, so doch mit dem Stock gezüchtigt hätte. Und inmitten dieser wilden, von Blut und Rachsucht beherrschten Reflexionen fiel sein Blick auf jene junge Frau, die ihm schon bei seiner Ankunft aufgefallen war.
Die Sklavin mit dem dunklen Haar.
Sie überquerte den Hof in Richtung Gesindehaus, in den Armen einen Korb mit Wäsche, die nicht nass werden sollte.
Wie am Abend war Guillaume auch jetzt gebannt von ihrer Schönheit. Spontanes Verlangen überkam ihn, und plötzlich wusste er, wie er all der Wut und Frustration, die sich in seinem Inneren aufgestaut hatten, Ausbruch verschaffen konnte.
8.

»Conn? Conn! Wach auf …!«
Die Stimme kam aus weiter Ferne und schaffte es nicht, sein Bewusstsein zu erreichen. Unter einem Dachüberstand, der weit auf die Straße herabreichte und während des Winters Feuerholz beherbergte, hatte Conn vor dem Wolkenbruch Zuflucht gesucht. Da es nicht den Anschein gehabt hatte, dass der Regen rasch wieder aufhören würde, hatte er beschlossen, die Nacht an Ort und Stelle zu verbringen. Eine feste Bleibe hatte er ohnehin nicht, und aus Erfahrung wusste er, dass es weit schlechtere Schlafplätze gab als diesen.
An die Wand der Hütte gelehnt, hatte er die Gugel über den Kopf gezogen und die Augen geschlossen. Die wohlige Wärme der Kapuze und das gleichmäßige Trommeln des Regens hatten dafür gesorgt, dass er bald eingeschlafen war.
»Du sollst aufwachen, hörst du nicht?«
Erst als ihn eine Hand an der Schulter packte und unsanft rüttelte, kam er zu sich. Er blinzelte. Jemand war ebenfalls unter den Überstand geschlüpft und kauerte vor ihm am Boden, eine fast verloschene Fackel in der Hand. Das spärliche Licht reichte gerade noch aus, um das Gesicht des nächtlichen Besuchers zu beleuchten, und Conn erstarrte innerlich, als er Emma erkannte.
Sofort war er hellwach. »Emma, wie …?«
»Bin ich froh, dass ich dich gefunden habe«, presste die Magd mühsam hervor. Ihre Kleider waren durchnässt, ihr sonst rosiges Gesicht leichenblass. »Du musst mitkommen, auf der Stelle!«
»Was ist passiert?«
»Nia«, sagte die junge Frau nur – und das genügte, um ihn auf einen Schlag hellwach werden zu lassen.
»Was ist mit ihr?« Conn fühlte, wie ihm heiß und kalt wurde. Die Nacht und der prasselnde Regen hörten auf zu existieren, die Zeit schien stillzustehen.
»Sie … sie …«, versuchte Emma mit halb erstickter Stimme zu erklären.
Conn begriff, dass das Wasser in ihrem Gesicht nicht nur vom Regen rührte. Panik erfasste ihn. Ohne dass er es wollte, packte er die Magd bei den Schultern und schüttelte sie. »Emma, in Gottes Namen! Sag mir, was geschehen ist!«
»Ein normannischer Ritter … Guillaume de Rein …«
»Was ist mit ihm?«
»Er … er …«
Conn schloss die Augen, während er inständig zum Herrn flehte, dass das, was er befürchtete, nicht geschehen sein mochte. »Bring mich zu ihr«, forderte er Emma auf. »Kannst du das?«
Die Magd nickte stumm, offenbar erleichtert darüber, dass er auch so verstanden hatte. Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, beschloss Conn, sie nicht mehr zu fragen – er wollte zu Nia, das war alles. Seine Sehnsucht danach, sie zu sehen und in seine Arme zu schließen, war niemals größer gewesen als in diesem Augenblick.
»Dann los«, forderte er Emma auf, und sie huschten aus dem Unterstand. Jetzt erst brachten die Dunkelheit und der strömende Regen sich wieder in Erinnerung, feucht und kalt, aber Conn störte sich nicht daran. Weder merkte er, dass die Fackel nach wenigen Schritten verlosch und es stockfinster wurde, noch nahm er die Nässe wahr, die seine Kleider tränkte und die den gestampften Lehm der Straßen in einen einzigen Morast verwandelt hatte. Seine schäbigen Stiefel versanken bei jedem Tritt, ebenso wie Emmas nackte Füße, sodass sie nur mühsam vorankamen und es eine gefühlte Ewigkeit dauerte, die eigentlich nur kurze Distanz zur Burg zu überbrücken.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу