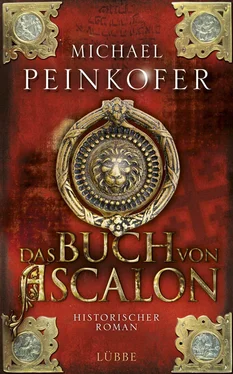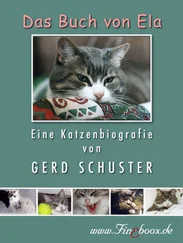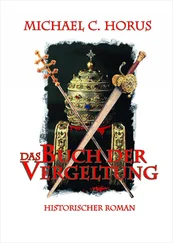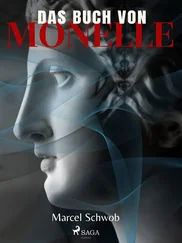»Was hat das zu bedeuten?«, fragte Conn.
»Du bist frei und kannst gehen.«
Conns Mund blieb ihm vor Staunen offen. Mit vielem hatte er gerechnet, damit jedoch ganz sicher nicht. »Warum?«
»Chaya«, sagte Caleb nur, und es klang seltsam gepresst. »Sie hat sich bei Bahram für dich verwendet.«
Inzwischen hatten auch der Hauptmann und sein feister Scherge die Zelle verlassen. Während der Kerkerknecht zurückblieb, um die Tür zu verschließen, bedeutete Bahram Conn, ihm den Gang hinab zu folgen. »Wohin gehen wir?«, erkundigte sich Conn bei Caleb.
»Du wirst schon sehen«, war die barsche Antwort.
Conn verzichtete auf weitere Fragen. Auf seinen schmerzenden Beinen, deren Gelenke noch immer geschwollen waren, folgte er Bahram und Caleb durch dunkle Stollen und die schmale Treppe hinauf, die zurück an die Oberfläche führte und von der er nicht geglaubt hatte, dass er sie jemals wieder emporsteigen würde.
Das Tageslicht schmerzte in Conns Augen, als sie auf den Innenhof traten. Er geriet ins Torkeln. Jemand fasste ihn am Arm und führte ihn, und er stellte verwundert fest, dass es Caleb war. Sie überquerten den Hof, auf dem Soldaten der Garnison an ihren Waffen übten, und betraten ein steinernes Gebäude. Sogleich ließ der stechende Schmerz in Conns Augen nach.
»Du sagst, Chaya hätte sich für mich verwendet?«, erkundigte er sich leise bei Caleb.
»Das hat sie.«
»Und wie? Ich meine, wie hat sie es geschafft, dass ich freigelassen werde?«
Der junge Jude antwortete nicht. Stattdessen führte er ihn durch eine Reihe von Gängen zu einer Tür. Die Posten, die sie begleiteten, blieben als Wachen zurück, während Bahram, Conn und Caleb in den dahinterliegenden Raum traten. Noch immer fragte sich Conn, was all dies zu bedeuten haben mochte, als er die Gestalt gewahrte, die zusammengesunken auf einem Hocker in der Mitte der Kammer kauerte.
Es war Baldric!
Conn brauchte einen Moment, um seine Überraschung zu verwinden.
Noch mehr als die Tatsache, dass er seinen Adoptivvater weit entfernt im Norden vermutet hatte, entsetzte ihn Baldrics Aussehen. Die Gesichtszüge des alten Normannen waren ausgezehrt, seine Wangen hohl, die Haut fleckig; Haupt und Kinn waren kahlgeschoren, eine hässliche Brandwunde entstellte die Mundpartie. Noch schlimmer war die kauernde Haltung, in der Baldric auf dem Schemel hockte, die Arme hängend, die Schulterknochen überdeutlich hervortretend. Dies war nicht der Mann, den er im Lager zurückgelassen hatte, und Conn brauchte nicht lange zu überlegen, was diese Veränderung bewerkstelligt haben mochte.
Mangel und Misshandlung hatten den einstmals stolzen Krieger zu jenem Schemen verblassen lassen, der dort im Halbdunkel saß – und neben dem Mitleid, das er empfand, verspürte Conn brennenden Zorn.
»Was habt ihr ihm angetan?«, wandte er sich an Caleb. »Genügt es nicht, dass ihr mich gefoltert habt?«
Er eilte zu Baldric, der am Ende seiner Kräfte schien. Mit Mühe nur hob er das Haupt, der Blick seines einen Auges war müde. Dennoch brachte er ein Lächeln zustande, als er Conn erblickte.
»Conwulf! Sohn!«, krächzte er.
»Vater!« Conn fiel bei ihm nieder und fasste ihn an den Armen. »Wieso bist du hier? Was haben die Heiden dir nur angetan?«
»Du elender Narr!«, fuhr Caleb ihn an. »Nicht Heiden waren es, die den Alten so zugerichtet haben, sondern Christenmenschen wie du!«
»Er hat recht, Junge«, sagte Baldric.
»Wer?« Conn kämpfte mit den Tränen der Wut. »Wer hat dir das angetan?«
»Guillaume de Rein«, lautete die leise Antwort. »Er sucht nach dir. Er hat mich gefoltert. Ich habe nichts verraten, aber dann hat er gedroht, Bertrand zu töten … Ich konnte nicht anders, bitte verzeih …«
Conn schloss die Augen. Er hatte Mühe, den rasenden Zorn zu unterdrücken, der aus ihm herauszubrechen drohte. Zorn auf Guillaume de Rein, der sich einmal mehr an einem geliebten Menschen vergriffen hatte – aber auch auf sich selbst. Er hatte alles darangesetzt, seine Freunde aus der Sache herauszuhalten und drohenden Schaden von ihnen abzuwenden. Gerade dadurch hatte er sie aber ans Messer geliefert.
»Da ist nichts zu verzeihen, Vater«, flüsterte er. »Ich bin ein Narr gewesen.«
Abermals hob der Alte den Blick und schaute ihn durchdringend an. »Wir waren beide Narren, Conwulf. Guillaume ist noch um vieles gefährlicher, als wir dachten, er schreckt vor keiner Untat zurück. Bertrand ist tot.«
»Was?«
Baldric nickte. »Sie haben ihn getötet, nachdem ich bereits gestanden hatte, ohne jeden Grund. Guillaume ist das Böse, Conwulf! Er will die Lade für sich.«
»Keine Sorge, er wird sie nicht bekommen. Ohne die Hinweise aus der Schriftrolle wird Berengar nicht in der Lage sein, das Versteck ausfindig zu machen, und ohne …« Er unterbrach sich, als er den ernsten, fast mitleidigen Ausdruck in Baldrics narbigen Zügen bemerkte. »Was ist, Vater?«
»Mein guter Junge! Genau wie ich hast du keine Ahnung, wie verschlagen das Böse sein kann.«
»Was meinst du?«
»Ich bin nicht hier, weil ich Guillaume entkommen bin, Conn«, gestand der Normanne leise und, so schien es, voller Selbstverachtung. »Ich bin hier als sein Bote.«
»Als sein Bote?« Conn schaute seinen Adoptivvater verständnislos an. Wovon, in aller Welt, sprach Baldric da? Wenn er in de Reins Auftrag in Acre war, dann weil dieser ihn dazu gezwungen hatte. Aber wie war das möglich? Was mochte der Schurke in der Hand haben, dass er sich einen Mann vom Schlage Baldrics gefügig machen konnte?
Ein hässlicher Verdacht keimte in Conn auf, aber er überging ihn geflissentlich, beruhigte sich damit, dass es schließlich nicht sein konnte und sie hier in Acre in Sicherheit war – bis Baldric seinen Ausflüchten ein jähes Ende setzte.
»Chaya«, erklärte er. »De Rein hat Chaya in seiner Gewalt.«
Für Conn fühlte es sich an, als würde ihm das Herz aus der Brust gerissen. Bilder der Vergangenheit tauchten vor seinem inneren Auge auf, Erinnerungen voller Schmerz und Trauer. Zuerst Nia. Nun Chaya.
»Was will er?«, fragte Conn leise und mit bebender Stimme, obwohl er am liebsten laut geschrien hätte. »Was will dieser Bastard?«
»Die Schriftrolle. Er weiß, dass du sie gestohlen hast. Wenn du sie ihm nicht innerhalb von zwei Tagen übergibst, wird Chaya sterben.«
Abermals schloss Conn die Augen, und größer noch als seine Empörung über Guillaume de Rein war seine Erleichterung darüber, dass Chaya noch am Leben war. Für Conn stand außer Frage, dass er das Buch von Ascalon herausgeben würde, selbst auf die Gefahr hin, dass Guillaume de Rein und seine Bruderschaft in den Besitz der heiligen Lade gerieten. Alles, was er brauchte, war die Schrift.
Conn wandte sich an Bahram und Caleb, die hinter ihm standen, der Jude wie zuvor mit unbewegter Miene, der Armenier mit einer Pergamentrolle in der Hand. Ein flüchtiger Blick genügte und Conn erkannte zu seiner Überraschung das Buch von Ascalon.
»Hauptmann Bahram kennt das Geheimnis«, sagte Caleb, wobei nicht zu erkennen war, wie er darüber dachte.
»Er kennt es? Aber woher? Wie …?«
»Chaya«, unterbrach ihn der andere. »Es war der Preis für deine Freiheit.«
Jäh erfasste Conn die bestürzende Wahrheit.
Um seine Freilassung zu erwirken, hatte Chaya Bahram das Geheimnis des Buches von Ascalon offenbart. Was ihr Vater unter Einsatz seines Lebens gehütet hatte, hatte sie preisgegeben, um Conns Leben zu retten – und war nun selbst in Todesgefahr geraten.
»Gebt mir das Buch«, sagte Conn und deutete auf die Schriftrolle.
»Wozu?«, fragte Caleb.
»Um Chaya auszulösen. De Rein will das Buch haben, also geben wir es ihm und befreien Chaya.«
»Und du glaubst, es wäre so einfach?«
Conn erhob sich. »Willst du etwa, dass sie getötet wird?«
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу