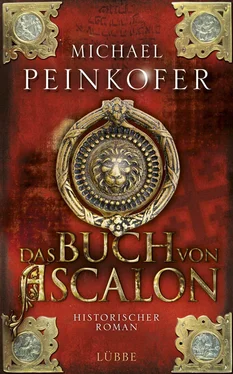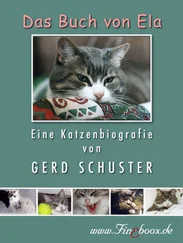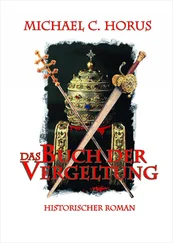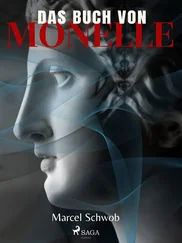Seine Mutter hatte Guillaumes Vorbehalte stets verstanden. Sie stammte aus vornehmem Hause und wusste um den Wert normannischer Tradition und normannischen Wesens. Anders als sein Vater, der all dies weit hinter sich gelassen zu haben schien und – so jedenfalls hatte es den Anschein – schon fast selbst ein Engländer geworden war. Guillaume hatte nie verstanden, weshalb sein Vater nach dem Sieg über die Angelsachsen nicht aufs Festland zurückgekehrt war, zumal König William es ihm in Aussicht gestellt hatte. Doch Renald de Rein, von Einfalt, von Ehrsucht oder auch von beidem getrieben, hatte seinen König gebeten, in England bleiben zu dürfen, und wurde – wohl mehr aus Spott denn aus dankbarer Verbundenheit – mit einem Lehen in Northumbria bedacht, dem am weitesten nördlich gelegenen Teil des Reichs, der fortwährend bedroht wurde, nicht nur von den Schotten, die jenseits der Grenzen hausten, sondern auch von ständiger Revolte.
Hätte seine Torheit nur ihn selbst betroffen, hätte Guillaume seinem Vater wohl vergeben. Dass er seine Mutter und ihn jedoch nachgeholt und sie beide ebenfalls in dieses ungastliche, neblige und von Insekten verseuchte Land bestellt hatte, hatte er ihm nie verziehen. Hier gab es nichts, an dem der Geist sich erfreuen und an dem die Seele sich laben konnte. Eintönigkeit und Ödnis prägten das Leben auf Burg de Rein, Waffengänge mit rebellierenden Gefolgsleuten des Königs und unbelehrbaren piktischen Barbaren waren an der Tagesordnung. Die Einladung nach London war daher freudig begrüßt worden, und das nicht nur von Guillaume. Auch seine Mutter Eleanor hatte darauf bestanden, ihren Gatten an den königlichen Hof zu begleiten – ein weiterer Grund dafür, dass die Reise länger gedauert hatte als sonst.
Als die kahle Steinmauer endlich vor ihnen auftauchte, die schon das alte Londinium umgürtet hatte und die Wälder östlich der Stadt von den bewirtschafteten Feldern schied, war die Erleichterung entsprechend groß. Und obwohl Guillaume dieses Land nicht mochte und seine Bewohner zutiefst verachtete, kam er nicht umhin, beeindruckt zu sein, als sich das Burgtor vor ihnen öffnete und sie in den Innenhof einritten.
Zuletzt war er als Knabe in London gewesen, und obwohl sich der Donjon bereits im Bau befunden hatte, war davon wenig mehr zu sehen gewesen als die Grundmauern. Inzwischen jedoch war er zu imposanter Größe angewachsen. Auf beinahe quadratischem Umriss, von drei trutzigen Türmen und einer gerundeten Ausbuchtung flankiert, die eine Kapelle zu beherbergen schien, bot der Turm von London einen großartigen Anblick, der den alten normannischen Glanz zumindest erahnen ließ. Guillaume musste grinsen bei dem Gedanken, welchen Eindruck das Bauwerk auf die Angelsachsen machen musste, deren gedrungene, aus Holz und Lehm erbaute Hütten nur ein Stockwerk und ein strohgedecktes Dach besaßen. Wenigstens, dachte er, konnte beim Anblick dieser Burg kein Zweifel mehr daran aufkommen, wer die Herren auf diesem unwirtlichen Flecken Erde waren.
Der Stallmeister und einige Knechte warteten im Hof, um die Pferde in Empfang zu nehmen und den Frauen beim Absteigen behilflich zu sein. Guillaume sprang leichtfüßig aus dem Sattel und eilte dann zu seiner Mutter. Den Stallknecht verscheuchte er mit einem unwirschen Laut, noch ehe dieser auch nur Anstalten machen konnte, sie zu berühren.
Eleanor de Rein waren die Strapazen des langen Ritts anzusehen. Sie war ohnehin von schlanker, fast knochiger Gestalt, und ihre Haut zeichnete sich durch auffallende Blässe aus, woran auch die vieltägige Reise unter freiem Himmel nichts hatte ändern können. Im Gegenteil schien die Baronin während der letzten Wochen noch bleicher geworden zu sein. Das helle Blau ihres Mantels und das Gebende, das ihre markanten Gesichtszüge umrahmte und ihr die würdevolle Strenge einer Äbtissin verlieh, unterstrichen diesen Eindruck noch. Wer von Eleanors zerbrechlich wirkendem Äußeren jedoch auf ihr Wesen schloss, der beging einen verhängnisvollen Fehler. Denn die auf den ersten Blick so blutarme Hülle barg einen messerscharfen, berechnenden Verstand, für den Guillaume seine Mutter immer bewundert hatte. Und der Blick ihrer grünen, ob der Anstrengung dunkel geränderten Augen machte klar, dass sie sich ihrer Herkunft und ihres Standes stets bewusst war.
»Danke, Sohn«, sagte sie, nachdem er sie aus dem Sattel gehoben und sanft auf dem Boden abgesetzt hatte.
»Wie fühlt Ihr Euch, Mutter?«
»Wie soll ich mich fühlen?« Ein freudloses Lächeln spielte um ihren schmalen Mund. »Wie sich ein frommer Pilger in einem gottlosen Land eben fühlen muss.«
Guillaume erwiderte das Lächeln. Wie so oft schien seine Mutter genau wie er zu empfinden. Mit dem Unterschied, dass sie den Mut hatte, es auszusprechen, während er selbst …
»Guillaume!«
Der Ruf seines Vaters ließ ihn zusammenzucken. Er kannte diesen Tonfall nur zu genau, und stets bedeutete er Verdruss.
»Ja, Vater?«
Guillaume wandte sich um. Vor ihm stand der Baron de Rein. Wie er selbst trug er ein Kettenhemd, das bis zu den Knien reichte und vorn und hinten geschlitzt war, um das Sitzen im Sattel zu erleichtern. Anders als Guillaume, der nach seiner Mutter kam und von schlankem Wuchs war, bot Renald de Rein jedoch eine eindrucksvolle, fast hünenhafte Erscheinung mit breiter Brust und starken Armen, die keinen Zweifel daran ließen, dass er das Langschwert, das an seiner Hüfte hing, mit wuchtigen Schlägen zu führen wusste. Den Helm hatte der Baron abgenommen, sodass sein rotbraunes, in schweißnassen Strähnen hängendes Haar, das ohnehin mehr an einen Angelsachsen denn an einen Normannen gemahnte, wie Kupfer in der fahlen Nachmittagssonne glänzte. Das fleischige Gesicht mit der gebogenen Nase und den hohen Wangenknochen verriet unverhohlene Missbilligung.
»Wenn du damit fertig bist, am Rockzipfel deiner Mutter zu hängen, kümmere dich darum, dass die Pferde gut versorgt und die Männer ordentlich untergebracht werden.«
»Aber Vater«, beeilte Guillaume sich zu versichern, »ich wollte doch nur, dass Mutter …«
»Erspare mir deine Ausreden«, fiel Renald ihm ins Wort. »Unsere Leute sind müde und hungrig, also trage dafür Sorge, dass sie ein Dach über dem Kopf und eine anständige Mahlzeit erhalten.«
Guillaumes hohe Stirn verfinsterte sich. Er hasste es, vor den Untergebenen gemaßregelt zu werden, und sein Vater wusste das – was ihn nicht davon abhielt, es wieder und wieder zu tun. »Ich bin ebenfalls geritten«, erklärte er mit unverhohlenem Trotz in der Stimme, »und ich bin nicht weniger hungrig.«
»Glaubst du, das interessiert mich?« Der Baron gab sich keine Mühe, seine Verachtung zu verbergen. »Diese Leute«, sagte er, auf die Soldaten und die Dienerschaft deutend, die sie auf dem langen Weg nach London begleitet hatten, »sind mit uns gereist und haben uns mit ihrem Leben beschützt. Als ihr Oberhaupt ist es deine Pflicht, für sie zu sorgen, noch bevor du an dein eigenes Wohl denkst. Geht das in deinen blonden Schädel?«
Guillaume verzog angewidert das Gesicht. Er mochte es nicht, wenn sich sein Vater ihm gegenüber solch grober Worte bediente, auch seiner Mutter war das Missfallen deutlich anzusehen. Beide wussten jedoch, dass es weder Sinn gehabt hätte noch besonders klug gewesen wäre, dem Baron vor seinen Gefolgsleuten zu widersprechen, also schwiegen sie, und Guillaume deutete, wenn auch zähneknirschend, eine Verbeugung an.
»Natürlich, Vater. Ihr habt wie immer recht.«
Renald brummte eine unverständliche Erwiderung, und Guillaume setzte sich in Richtung der beiden schlanken, zweistöckigen Steingebäude in Bewegung, die die Südmauer der Burg säumten und wo er die Unterkünfte der örtlichen Garnison vermutete.
Die Gedanken, denen er dabei nachhing, handelten von Rachsucht und Revolte, und er schwor sich, dass er seinem Vater all die Erniedrigungen und Zurechtweisungen einst in gebührender Form heimzahlen würde. Plötzlich war ihm jedoch, als würde die Düsternis seiner Gedanken von einem hellen Lichtstrahl durchbrochen. Klar und leuchtend drang er hindurch, in Gestalt einer jungen Frau, die am Brunnen stand und Wasser schöpfte.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу