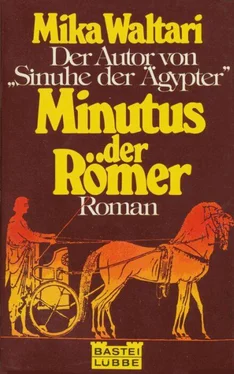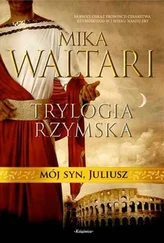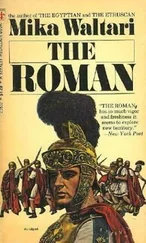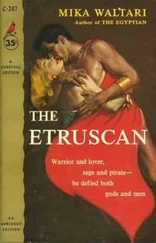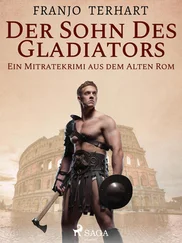Claudia sah ihre Dummheit wohl ein, erwiderte aber zornig: »Man kann immerhin fragen, das schadet niemandem. Sie sagen, sie hätten sich bisher nicht in die Politik eingemischt und gedächten auch in Zukunft der Obrigkeit zu gehorchen, wie immer diese Obrigkeit beschaffen sein möge. Sie hätten ihr eigenes Reich, das kommen werde, sagen sie, aber ich bin es nun müde, darauf zu warten. Als Tochter des Claudius und Mutter meines Sohnes muß ich wohl auch ein wenig an die weltliche Macht denken. Kephas, der immerzu nur von Gehorsam schwatzt, ist in meinen Augen ein Feigling. Das unsichtbare Reich mag eine schöne Sache sein, aber seit ich Mutter bin, rückt es mir immer ferner, und ich fühle mich mehr als Römerin denn als Christin. Die verworrene Lage bietet uns die beste Möglichkeit, die Welt zu verändern, nun da alle Menschen um jeden Preis Frieden und Ordnung wünschen.«
»Die Welt verändern … Was soll das heißen?« fragte ich mißtrauisch. »Bist du bereit, vorsätzlich Tausende, vielleicht Millionen Menschen in Hunger und Not zu stürzen, ja in den Tod zu treiben, um für deinen Sohn, bis er die Toga anlegt, ein günstiges politisches Klima zu schaffen?«
»Die Republik und die Freiheit sind Dinge, für die schon so mancher tapfere Mann bereit war, sein Leben dranzugehen«, sagte Claudia gereizt. »Mein Vater Claudius sprach oft mit großer Achtung von der Republik, und er hätte sie gern wiedereingeführt, wenn es möglich gewesen wäre. Er sagte es oft genug in seinen weitschweifigen Reden in der Kurie, wenn er sich über die Last der Alleinherrschaft beklagte.«
»Du hast selbst oft genug behauptet, dein Vater sei ein wahnsinniger, ungerechter und grausamer Lüstling gewesen«, erwiderte ich. »Erinnere dich, daß du seine Statue in der Bibliothek bespucktest, als wir uns zum erstenmal begegneten. Es ist unmöglich, die Republik wiedereinzuführen. Dieser Plan findet nicht genug Unterstützung. Die Frage ist nur, wen wir zum Kaiser machen sollen. Piso halte ich für zu unbedeutend, und ich weiß, daß du mir recht gibst. An wen hast du gedacht?« Claudia sah mich nachdenklich an und sagte plötzlich mit gespielter Unschuld: »Was meinst du zu Seneca?«
Im ersten Augenblick entsetzte mich dieser Gedanke. »Was nützt es, einen Zitherspieler gegen einen Philosophen auszutauschen?« fragte ich. Je mehr ich jedoch darüber nachdachte, desto schlauer fand ich Claudias Vorschlag. Sowohl das Volk als auch die Provinzen waren der Meinung, daß die ersten fünf Jahre Neros, in denen Seneca regierte, die glücklichste Zeit gewesen waren, die Rom je erlebt hatte. Noch heute – da wir sogar für die Benutzung der öffentlichen Abtritte Steuern zahlen müssen – spricht man davon als von einer goldenen Zeit.
Seneca war ungeheuer reich. Man schätzte sein Vermögen auf dreihundert Millionen Sesterze, aber ich wußte, daß das zu knapp geschätzt war. Das beste aber war, daß Seneca schon sechzig Jahre zählte. Dank seinen stoischen Lebensgewohnheiten konnte er noch gut fünfzehn Jahre leben. Daß er in ländlicher Abgeschiedenheit wohnte, dem Senat fernblieb und nur selten die Stadt besuchte, war nichts als Schein, um Nero zu beruhigen.
Die Diät, die er seines Magenleidens wegen einhielt, hatte ihm gutgetan. Er war schlank geworden und keuchte beim Gehen nicht mehr. Auch die feisten Wangen, die einem Philosophen so schlecht anstehen, hatte er verloren. Man konnte sich vorstellen, daß er gut regieren, niemanden verfolgen und als erfahrener Geschäftsmann das Wirtschaftsleben fördern und mit den Staatsgeldern gut haushalten würde. Und wenn sein Ende nahte, würde er vielleicht freiwillig bereit sein, die Macht einem jungen Manne zu übergeben, der in seinem Geiste erzogen worden war.
Senecas sanfte Gemütsart und Menschenliebe entsprachen in hohem Maße der Lehre der Christen. In einem naturwissenschaftlichen Werk, das er unlängst geschrieben hatte, deutete er an, daß es, in der Natur und im All verborgen, geheime Mächte gebe, die menschliche Vernunft überstiegen, so daß das Seiende und Sichtbare nicht mehr sei als ein dünner Schleier, der etwas Unsichtbares verdeckt. Er hatte mit Paulus Briefe gewechselt, und ich könnte nicht mit Gewißheit sagen, wer von den beiden in seinen Schriften die Gedanken des andern entlehnte. Paulus schrieb ebenso fleißig Briefe, wie Seneca seine philosophischen Gedanken in Briefform ausdrückte.
Als ich all dies bedacht hatte, schlug ich vor Verwunderung die Hände zusammen und rief: »Claudia, du bist ein politisches Genie, und ich bitte dich, mir meine bösen Worte zu verzeihen!«
Selbstverständlich sagte ich ihr nicht, daß ich mir, indem ich Seneca vorschlug und sodann unterstützte, die Schlüsselstellung in der Verschwörung verschaffen konnte, die ich anstrebte. Auch wäre mir Senecas’ Dankbarkeit gewiß gewesen. Zudem war ich sozusagen einer seiner Schüler, und in Korinth hatte ich unter seinem Bruder als Kriegstribun gedient und dessen Vertrauen in geheimen Staatsgeschäften genossen. Und Senecas Vetter, der junge Lucanus, gehörte zu meinen besten Freunden, da ich nie genug des Lobes für seine Verse fand. Ich war ja selbst kein Dichter.
Wir plauderten noch lange im besten Einvernehmen, Claudia und ich, und gewannen, während wir eifrig dem Wein zusprachen, unserer Sache immer mehr gute Seiten ab. Zuletzt gingen wir zu Bett, und ich kam seit langem zum erstenmal wieder meinen ehelichen Pflichten nach, um jedes Mißtrauen, das sie etwa noch gegen mich hegte, zu zerstreuen.
Als ich dann neben ihr erwachte, vom Wein und von meiner Begeisterung erhitzt, dachte ich mit Kummer im Herzen daran, daß ich mich eines Tages um Deinetwillen von Deiner Mutter befreien mußte. Antonia konnte sich mit einer gewöhnlichen Scheidung nicht zufriedengeben. Claudia mußte sterben, doch erst in zehn oder fünfzehn Jahren, und bis dahin konnte viel geschehen. Noch oft werden bis dahin die Schmelzfluten des Frühjahrs unter den Tiberbrücken dahinströmen, sagte ich mir. Und dann gab es Seuchen und Krankheiten, unerwartete Unglücksfälle aller Art und über allem die Parzen, die die Geschicke der Menschen lenken. Ich brauchte mich nicht im voraus zu sorgen, wie das Unausweichliche einst geschehen sollte.
Claudias Plan erschien mir so ungewöhnlich, aber auch so selbstverständlich, daß ich es nicht für nötig hielt, mit Antonia darüber zu sprechen. Wir durften uns nur selten und heimlich treffen, damit kein böses Gerede entstand und Nero, der Antonia aus politischen Gründen beobachten ließ, nicht Verdacht schöpfte.
Ich reiste unverzüglich selbst zu Seneca, indem ich vorgab, ich hätte in Praeneste einige Geschäfte zu besorgen und wollte dem alten Philosophen nur einen Höflichkeitsbesuch abstatten. Sicherheitshalber richtete ich es so ein, daß ich tatsächlich in Praeneste zu tun hatte.
Seneca empfing mich freundlich, und ich überzeugte mich, daß er auf seinem Gut mit seiner um die Hälfte jüngeren Gattin bequem und im Überfluß lebte. Anfangs saß er mir zwar ächzend und mit krummem Rücken gegenüber und jammerte über seine Krämpfe, aber als er erkannte, daß ich ernsthaft mit ihm zu sprechen wünschte, führte mich der alte Fuchs zu einem abseits gelegenen Lusthaus, wo er fern der Welt ein asketisches Leben führte und einem Schreiber seine Werke diktierte.
Um mir zu beweisen, daß er wirklich einfach und bescheiden lebte, zeigte er mir einen Bach, aus dem er mit der hohlen Hand sein Trinkwasser schöpfte, und einige Obstbäume, von denen er selbst sich pflückte, wonach es ihn gelüstete. Er erzählte mir auch, daß seine Gattin Paulina gelernt hatte, Korn mit einer Handmühle zu mahlen und Brot zu backen. Ich kannte diese Zeichen und begriff, daß er in der ständigen Furcht lebte, vergiftet zu werden. In seiner Geldnot konnte Nero nur allzu leicht Lust auf das Vermögen seines alten Lehrers bekommen und es auch sonst aus politischen Gründen für nötig erachten, sich seiner zu entledigen. Seneca hatte noch immer allzu viele Freunde, die ihn als Philosophen und Staatsmann schätzten, obgleich er um seiner Sicherheit willen nur selten Gäste empfing.
Читать дальше