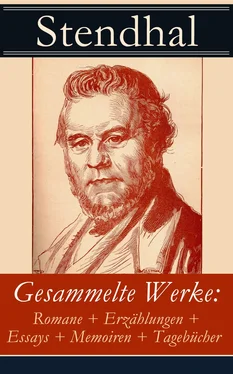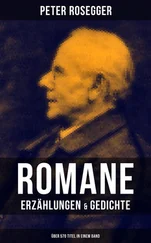Mit kindlichem Vergnügen sammelte Julian eine Stunde lang die Wörter. Als er dann aus seinem Zimmer trat, begegnete er seinen Zöglingen und ihrer Mutter. Sie nahm ihm den Brief mit Selbstverständlichkeit und Kaltblütigkeit ab.
»Ist der Klebestoff auch schon trocken?« fragte sie.
Er war verblüfft. »Ist das die Frau, die vor Reue beinahe den Verstand verlieren wollte?« dachte er. »Was hat sie vor?« Er war zu stolz, sie darob zu fragen. Aber nie hatte sie ihm so gut gefallen.
»Wenn die Sache schief geht«, sagte sie in gleichgültigem Tone, »so wäre ich mittellos. Vergraben Sie diese Wertsachen irgendwo in den Bergen! Vielleicht ist das eines Tages meine letzte Rettung.«
Dabei steckte sie ihm ein niedliches Juchtenledertäschchen mit ein paar Goldstücken und Brillanten zu.
»Geh jetzt!« befahl sie, nachdem sie die Kinder geküßt hatte.
Julian rührte sich nicht. Raschen Schrittes verließ sie ihn, ohne ihn noch einmal anzusehen.
Von dem Augenblick an, wo Herr von Rênal den anonymen Brief geöffnet hatte, war ihm das Dasein eine Qual. Seit dem Duell, das er 1816 beinahe gehabt hätte, war er nicht wieder dermaßen in Erregung gewesen. Unleugbar hatte ihn der Gedanke, niedergeschossen zu werden, damals lange nicht so unglücklich gemacht wie jetzt der Brief. Er untersuchte ihn nach allen Richtungen. »Ist das nicht die Handschrift einer Frau?« fragte er sich. »Und wenn dem so wäre, welches Frauenzimmer hat das geschrieben?«
Er ging sämtliche ihm bekannte Frauen von Verrières durch, ohne einen bestimmten Verdacht zu schöpfen. »Sollte ein Mann den Wisch diktiert haben? Aber wer?« Auch diese Erwägung brachte kein Ergebnis. Er wußte, daß fast alle seine Bekannten ihm nichts Gutes und alles Schlechte gönnten.
»Ich muß einmal meine Frau fragen«, sagte er sich schließlich, wie er dies gewohnt war. Er erhob sich von dem Lehnstuhle, in den er gesunken war.
Kaum aufgestanden, schlug er sich vor die Stirn. »Beim Teufel!« sagte er sich. »Der muß ich doch vor allem mißtrauen! Sie ist jetzt mein Feind!« Tränen der Wut traten ihm in die Augen.
Es war eine gerechte Vergeltung, daß dieser herzlose Mensch, dieser echte Provinzler, an den beiden Menschen, die seine besten Freunde waren, in diesem Augenblick am meisten zweifelte.
»Des weiteren habe ich etwa zehn Freunde!« murmelte er vor sich hin. Er ließ sie im Geiste an sich vorüberziehen, wobei er bei jedem abwog, wie er ihn mehr oder weniger trösten würde. »Unsinn!« knirschte er. »Allen miteinander wird mein schändliches Mißgeschick eine Riesenfreude bereiten!« Dann wieder dachte er daran, daß er ein vielbeneideter Mann war. Wohlbegründetermaßen. Außer seinem prächtigen Stadthause, das durch den Aufenthalt Seiner Majestät auf ewig berühmt geworden war, besaß er das schmucke Schloß Vergy. Er hatte es blendendweiß anstreichen und die Fenster mit freundlichen grünen Läden schmücken lassen. Man sah das Schloß in einem Umkreise von drei bis vier Wegstunden. Es stach alle andern Landhäuser und sogenannten Schlösser der Nachbarschaft aus in ihrer altersgrauen Armseligkeit.
Herr von Rênal konnte höchstens auf das Mitleid eines einzigen Freundes rechnen, nämlich des Kirchenvorstands von Verrières. Aber das war ein alter Schwachkopf, der bei jeder Gelegenheit in Tränen schwamm. Und dieser Mann sollte seine Zuflucht sein?
»Ich bin das unglücklichste aller Menschenkinder!« rief er voll Grimm und Bitternis. »Ach, wie bin ich einsam!« Er seufzte tief auf. »Soll ich in meinem Unglück keinen einzigen Freund haben, mit dem ich mich beraten kann? Ich selber verliere ja den Verstand. Ich fühle es. O Falcoz, o Ducros, ihr seid gerächt!«
Das waren zwei Jugendfreunde, die er sich in seinem Dünkel 1814 entfremdet hatte. Sie waren nicht adelig, und er hatte die Kameradschaft, die zwischen ihnen von jeher gewaltet hatte, eindämmen wollen. Der eine der beiden, Falcoz, ein kluger und wackerer Mensch, war erst Papierhändler in Verrières gewesen; später hatte er sich in Besançon eine Buchdruckerei gekauft und eine Zeitung gegründet. Aber die Pfaffen beschlossen seinen Untergang. Infolgedessen wurde ihm die Druckerlaubnis entzogen und sein Blatt unterdrückt. Unter so traurigen Verhältnissen hatte Falcoz es gewagt, zum erstenmal nach zehn Jahren wieder an Herrn von Rênal zu schreiben. Der Bürgermeister von Verrières hielt sich für verpflichtet, ihm im Stil eines alten Römers zu antworten: »Wenn das Königliche Ministerium des Innern mein Gutachten hierüber einzuverlangen geruhen wollte, so würde ich es wie folgt formulieren: Man muß ohne Gnade und Barmherzigkeit sämtlichen Provinzdruckereien ein Ende bereiten und aus dem Druckgewerbe ebenso ein Staatsmonopol machen wie aus der Tabakfabrikation.« Jetzt erinnerte sich Rênal schaudernd seiner Antwort an den ehemaligen Freund, den damals ganz Verrières bedauerte. »Das hätte mir keiner gesagt, daß ich, der Bürgermeister, Großgrundbesitzer und Ritter, dies einmal bereuen würde!«
In solchen Zornesanfällen, bald gegen sich selbst, bald gegen seine gesamte Umgebung, verbrachte er eine schreckliche Nacht. Auf den Gedanken aber, seine Frau zu belauern, kam er zum Glück nicht.
»Ich bin an Luise gewöhnt. Sie ist in alle meine Angelegenheiten eingeweiht. Wenn ich morgen frei wäre und wieder heiraten wollte, fände ich keine, die sie mir ersetzte.« Nun umschmeichelte ihn der Gedanke, seine Frau sei schuldlos. Bei dieser Annahme sah er sich nicht mehr gezwungen, den Mann von Charakter zu spielen. Gab es eine einfachere Lösung? »Welche Frau hätte man nicht schon verleumdet?« fragte er sich.
»Das hat aber auch seinen Haken!« rief er plötzlich aus und ging nervös auf und ab. »Soll ich gar dulden, wie ein obskurer armer Teufel, daß sie sich mitsamt ihrem Liebsten über mich lustig macht? Soll sich ganz Verrières über meine Trottelhaftigkeit ins Fäustchen lachen? Soll ich einen zweiten Charmier abgeben?« (Charmier war ein Mann, den seine Ehefrau tatsächlich hinterging.) »Zieht nicht ein Grinsen über aller Mienen, wenn die Rede auf ihn kommt? Er ist ein guter Advokat, aber wer rühmt seine forensischen Talente? Spricht man nicht immer bloß: Charmier, ach der! Das ist doch der mit den Hörnern!«
Dann sagte er sich wieder: »Gott sei Dank, daß ich keine Tochter habe. Wenn ich meine Frau gehörig bestrafe, so schadet das wenigstens meinen Kindern nicht. Ich kann diesen Bauernlümmel bei meiner Frau überraschen. Sie alle beide erdolchen! In diesem Falle beseitigt die Tragik alles Lächerliche.« Die Idee gefiel ihm. Er überlegte sie sich bis in die Einzelheiten. »Das Strafgesetzbuch habe ich auf meiner Seite«, sagte er sich, »und was auch geschehen mag, die Geistlichkeit und meine Freunde unter den Geschworenen werden mir zum Freispruche verhelfen.«
Er prüfte seinen Hirschfänger. Er war haarscharf, aber bei dem Gedanken an Blut gruselte es ihn.
»Ich könnte diesen frechen Hauslehrer lendenlahm prügeln und aus dem Hause jagen. Aber was gäbe das für einen Skandal in Verrières und im ganzen Kreise! Nach dem Prozesse gegen die Falcozsche Zeitung, als ihr Hauptschriftleiter aus dem Gefängnis entlassen wurde, da habe ich dabei geholfen, daß er seine Stellung mit zweihundert Talern Gehalt nicht wieder bekam. Neuerdings soll sich der Schmierifax in Besançon wieder mausig gemacht haben. Er kann mich geschickt anpöbeln, und zwar so, daß es unmöglich ist, ihn gerichtlich zu fassen. Und wenn man es versucht, so fabelt der unverschämte Kerl vor den Schöffen gar vom Wahrheitsbeweis usw. Ein hochgeborener Mann, der seinen Rang wahrt wie ich, wird naturgemäß von allen Plebejern gehaßt. Ich würde durch alle Schandblätter von Paris gezerrt! Allmächtiger, welch ein Sturz von der Höhe! Der gute alte Name derer von Rênal im Schmutze der Lächerlichkeit! Wenn ich dann einmal eine Reise mache, muß ich es unter falschem Namen tun. Ich meinen Namen lassen, der mein Stolz, mein ein und alles ist! Wie bin ich unglücklich!
Читать дальше