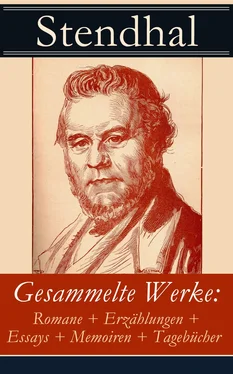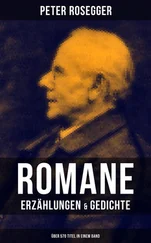»Ich vergegenwärtige mir«, unterbrach Rênal sie heftig, »daß du gegen mich weder Rücksicht noch Freundschaft kennst!« Die volle Bitternis der Erinnerung an jene Dinge sprach aus ihm. »Wenn ich wenigstens Pair geworden wäre!«
»Ich denke, mein Lieber«, erwiderte Frau von Rênal lächelnd, »daß ich einmal reicher sein werde denn du, daß ich seit zwölf Jahren deine Kameradin bin, und daß ich dadurch auch ein Wörtchen im Hause mitzureden habe, zumal in einer Angelegenheit wie der heutigen …« Und mit kaum verhohlener Entrüstung setzte sie hinzu: »Wenn dir Julian mehr wert ist als ich, so bin ich bereit, den Winter bei meiner Tante zuzubringen.« Die letzten Worte brachte sie meisterhaft heraus. Es lag bei aller Höflichkeit Bestimmtheit in ihrem Auftreten. Herr von Rênal fügte sich innerlich. Aber wie das Kleinstädter machen: er redete noch lange hin und her und kam auf sämtliche Argumente noch einmal zurück. Seine Frau ließ ihn räsonieren.
Endlich, nach zwei Stunden nutzloser Rederei, bekam er es selber satt. Seine Kräfte waren zu Ende, zumal er die ganze Nacht vor Wut nicht geschlafen hatte. Sein Plan, wie er sich Valenod, Julian und schließlich Elisen gegenüber verhalten wollte, war gefaßt.
Ein-oder zweimal während dieser großen Szene war Frau von Rênal nahe daran, mit dem Manne, der zwölf Jahre lang ihr Lebensgefährte gewesen, Mitgefühl zu empfinden. Aber große Leidenschaft ist egoistisch.
Ihre fortwährende Erwartung, er werde den gestern abend eingegangenen Brief erwähnen, erfüllte sich nicht. Frau von Rênal fühlte sich nicht völlig sicher, ehe sie nicht wußte, was man ihrem Manne alles aufgeredet hatte. Ein Ehemann hat das Schicksal seiner Frau in der Hand. Er kann sie durch die öffentliche Verachtung morden. Dies geschieht, wenn sich ihr alle Salons verschließen.
Dieses Gefühl der Gefahr war so mächtig in Frau von Rênal, daß sie sich in ihr Zimmer zurückzog. Die Unordnung, in der sie es fand, entsetzte sie. Die Schlösser aller Schubfächer ihres hübschen Schreibtisches waren erbrochen. »Daran sieht man, wie erbarmungslos er gewesen wäre!« sagte sie sich. Der Anblick dieser Brutalität verscheuchte ihre letzten Skrupel.
Kurz vor Essenszeit kam Julian zurück. Beim Nachtisch, als sich die Dienstboten entfernt hatten, sagte Frau von Rênal trocknen Tones zu ihm: »Sie haben mich gebeten, Herr Sorel, auf vierzehn Tage nach Verrières gehen zu dürfen. Herr von Rênal hat Ihnen diesen Urlaub bewilligt. Sie können ihn antreten, wann es Ihnen beliebt. Aber damit die Kinder nichts versäumen, werden Ihnen ihre Arbeiten täglich zur Durchsicht zugehen.«
Herr von Rênal fügte griesgrämig hinzu: »Das heißt: von mir aus haben Sie nur acht Tage!«
Julian ersah aus seinem Gesicht die Nervosität eines arg gequälten Mannes.
»Er hat noch immer keinen festen Entschluß«, meinte Julian zu seiner Freundin, als sie einen Augenblick allein im Salon waren. Sie erzählte ihm rasch alles. »Heute nacht Näheres!« schloß sie vergnügt.
»Sind die Weiber doch verdorben!« dachte Julian. »Es ist ihnen ein Genuß, uns zu hintergehen. Sie tun es triebmäßig.« Laut sagte er, nicht ohne leichte Kühle, zu Frau von Rênal: »Ich finde, die Liebe hat dich scharfäugig und blind zugleich gemacht. Du hast dich heute bewundernswert benommen. Ist es aber klug, uns heut nacht zu sehen? Das Haus wimmelt von Feinden. Denke nur an Elisens leidenschaftlichen Haß gegen mich!«
»Dieser Haß hat große Ähnlichkeit mit deiner leidenschaftlichen Gleichgültigkeit gegen mich!«
»Gleichgültig oder nicht gleichgültig: ich muß dich retten aus der Gefahr, in die ich dich gestürzt habe. Elise kann deinem Mann mit einem einzigen Worte alles verraten. Und was hindert ihn, in der Nähe meines Zimmers zu lauern, eine Waffe in der Hand?«
»Also nicht einmal Mut!« warf sie mit dem ganzen Hochmut einer vornehmen Dame hin.
Julian erwiderte kalt: »Niemals werde ich mich erniedrigen, von meinem Mut zu reden. Das wäre ordinär. Die Welt wird mich nach meiner Tat beurteilen!« Aber dann fügte er hinzu, indem er ihre Hand ergriff: »Ach, du ahnst ja nicht, wie sehr ich an dir hänge und wie groß meine Freude ist, daß ich dir vor dieser grausamen Trennung Lebewohl sagen darf!«
Kaum war Julian in Verrières, als er sich bereits Vorwürfe machte, gegen Frau von Rênal ungerecht gewesen zu sein. »Wenn sie bei ihrem Auftritt mit ihrem Manne versagt hätte, aus Inferiorität, so hätte ich sie als dummes Frauenzimmer verachtet. Aber sie hat sich meisterhaft diplomatisch benommen. Fast habe ich Mitleid mit dem Besiegten, obgleich er mein Feind ist. Es ist nicht gerade weltmännisch von mir. Ich fühle mich in meiner Eitelkeit verletzt. Schließlich ist Herr von Rênal ein Mann, das heißt Mitglied der großen erlauchten Körperschaft, der ich die Ehre habe anzugehören. Ich armer Schelm!«
Chélan hatte die Unterkunft abgelehnt, die ihm von den Liberalen des Ortes schier um die Wette angeboten worden war, als er bei seiner Amtsentsetzung das Pfarrhaus verlassen mußte. Die beiden Stuben, die er sich gemietet, standen voller Bücherkisten. Julian, der den Leuten zeigen wollte, daß sie sich um ihren alten Pfarrer zu kümmern hätten, holte bei seinem Vater ein Dutzend Tannenbretter, die er selber auf den Schultern durch die Hauptstraße schleppte, borgte sich bei einem Schulfreunde Handwerkszeug und zimmerte Bücherregale, in denen er die Bibliothek Chélans aufstellte. Unter Freudentränen dankte ihm der alte Mann: »Ich hielt dich für verdorben durch die eitle Welt, mein Sohn. Aber dies macht die Kinderei mit dem bunten Ehrengarderock wieder gut. Das hat dir viele Feinde bereitet.«
Herr von Rênal hatte Julian befohlen, im Rênalschen Hause zu wohnen. Kein Mensch ahnte, was vorgefallen war. Drei Tage nach seiner Ankunft wurde Julian in seinem Zimmer von keinem Geringeren als dem Landrat von Maugiron aufgesucht. Nach einem ewig langen Geschwätz über die Schlechtigkeit und Unredlichkeit der Menschen heutzutage, woran das arme Frankreich schließlich zugrunde gehen werde, kam Julian endlich hinter den Grund des Besuches. Schon waren die beiden im Flur an der Treppe, der armselige halbentlassene Hauslehrer und der hochmögende künftige Regierungspräsident, als dieser geruhte, auf Julians Zukunft anzuspielen und seine Begnügsamkeit hinsichtlich Gehalt usw. zu loben. Schließlich drückte Maugiron ihm väterlich die Hand und machte ihm den Vorschlag, Herrn von Rênal zu kündigen und zu einem Regierungsbeamten zu gehen, der einen Erzieher für seine Kinder brauche. Das dortige Gehalt betrage achthundert Franken, die nicht monatlich gezahlt würden, was nicht fein sei, sondern vierteljährlich und immer im voraus.
Jetzt ergriff Julian das Wort, auf das er lange genug hatte warten müssen. Was er erwiderte, war musterhaft, dazu langatmig wie eine Oberlandesgerichtsentscheidung. Er ließ allerlei durchblicken, sagte aber nichts Bestimmtes. Nach Belieben konnte Maugiron Ehrerbietung vor Herrn von Rênal, ungemeine Schätzung der öffentlichen Meinung von Verrières und tiefe Dankbarkeit gegen den hochwohllöblichen Landrat heraushören. Herr von Maugiron war erstaunt, einen noch größeren Jesuiten gefunden zu haben, als er selber war. Vergeblich gab er sich Mühe, etwas Greifbares aus ihm herauszubekommen. Zu seinem innigsten Vergnügen fand Julian Gelegenheit, sich im Disputieren zu üben. Er gab die nämliche Antwort immer wieder in neuer Fassung. Kein Machiavell hätte weniger in mehr Worten zu sagen verstanden.
Als der Landrat gegangen, fing Julian an, wie ein Verrückter zu lachen. Um seine schöne Jesuitenstimmung auszunutzen, schrieb er unverzüglich einen neun Seiten langen Brief an Herrn von Rênal, in dem er ihm berichtete, was ihm eben angeboten worden war, und ihn untertänigst um Rat bat. Dabei sagte er sich: »Dieser Schlaumeier hat mir aber doch nicht verraten, wer mir das Angebot eigentlich machen läßt! Höchstwahrscheinlich Valenod. Er vermutet in meiner Verbannung nach Verrières die erste Wirkung seines anonymen Briefes.«
Читать дальше