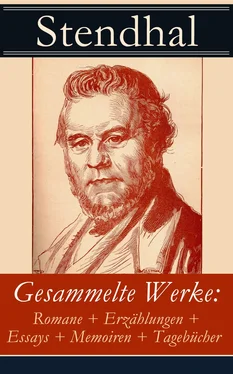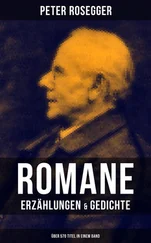»So, so!« meinte Julian und tat, als wüßte er nichts.
Mit der Entdeckung der Schwindelei war aber noch nichts erreicht. Es kam darauf an, weiterzureisen. Dies aber wollte Geronimo und Julian nicht gelingen. Schließlich meinte der Sänger: »Warten wir bis morgen! Man mißtraut uns. Vielleicht hat man es auf einen von uns beiden abgesehen. Wissen Sie, morgen früh bestellen wir uns ein gutes Frühstück. Während man es bereitet, machen wir einen Spaziergang, mieten uns Pferde und reiten nach der nächsten Poststation…«
»Und Ihr Gepäck?« fragte Julian. Es kam ihm in den Sinn, daß man am Ende gar Geronimo damit betraut habe, ihn abzufangen.
Es war Zeit zum Abendessen.
Darnach gingen sie zur Ruhe.
Julian lag noch im ersten Schlafe, als er auf einmal durch Stimmengeflüster aufgeweckt wurde. Es waren zwei Personen in seinem Zimmer, die ziemlich ungeniert miteinander sprachen.
Er erkannte den Postmeister, der eine Blendlaterne in den Händen hielt. Der Lichtschein fiel auf den Reisekoffer, den Julian ins Zimmer hatte bringen lassen. Neben dem Posthalter stand ein Mann, der den offenen Koffer in aller Ruhe durchsuchte. Julian vermochte nur die engen Ärmel seines schwarzen Rockes zu erkennen.
»Das ist eine Soutane«, sagte er sich, indem er behutsam nach den Taschenpistolen tastete, die er unter dem Kopfkissen hatte.
»Haben Sie keine Angst, Herr Pfarrer!« beteuerte der Postmeister. »Er wacht nicht auf. Ich hab ihm das Zeug in den Wein gegossen, das Sie mir gegeben haben.«
»Ich finde keine Spur von Papieren«, sagte der Geistliche. »Eine Menge Wäsche, Parfüm, Kopfwasser und allerhand Krimskrams. Das ist ein junger Lebemann, der nichts als sein Vergnügen im Kopfe hat. Der Bote wird eher der andere sein, der angebliche Italiener!«
Die beiden Personen näherten sich Julians Bett, um die Taschen seines Reiseanzuges zu durchsuchen. Er war in großer Versuchung, auf sie zu schießen wie auf Einbrecher. Aber das hätte die gefährlichsten Folgen gehabt. Er spürte die größte Lust dazu.
»Unsinn!« sagte er sich. »Ich wäre ein Narr! Ich setzte meine Mission aufs Spiel.«
Der Priester hatte Rock und Hosen durchschnüffelt und meinte: »Das ist kein Diplomat!«
Damit entfernte er sich vom Bette Julians – zu seinem Glücke.
»Wenn er mich anrührt, dann soll er was erleben!« schwur sich Julian. »Ich lasse mich nicht so einfach erdolchen…«
Der Priester wandte den Kopf. Julian öffnete ein wenig die Augen. Es war der Abbé Castanède! Die eine der beiden Stimmen war Julian von Anfang an bekannt vorgekommen.
Julian hatte maßlose Lust, die Welt von einem der gemeinsten Schurken zu befreien. Aber er sagte sich:
»Ich habe meine Mission zu erfüllen!«
Schließlich verließen die beiden Spione das Zimmer. Eine Viertelstunde später tat Julian, als sei er eben aufgewacht, und alarmierte das ganze Haus.
»Man hat mir Gift gegeben!« rief er laut. »Ich habe schreckliche Schmerzen!«
Er wollte einen Vorwand haben, um Geronimo zu Hilfe zu kommen. Er fand ihn halbtot von dem Opium im Weine.
Julian war auf derartige Scherze gefaßt gewesen. Deshalb hatte er seinen Wein nicht getrunken. Es gelang ihm nicht, den Sänger munter zu bekommen. Vom Weiterreisen wollte der gleich gar nichts wissen.
»Und wenn man mir das ganze Königreich Neapel böte«, erklärte Geronimo, »ich verzichtete nicht auf meinen himmlischen Schlummer.«
»Und die sieben regierenden Fürsten?« mahnte Julian.
»Die können warten!«
Julian fuhr allein ab und gelangte ohne weitere Zwischenfälle zu der hohen Persönlichkeit. Ein ganzer Vormittag ging ihm verloren, ohne daß er Audienz erlangen konnte. Glücklicherweise machte der Herzog gegen vier Uhr einen kleinen Spaziergang. Julian sah ihn zu Fuß weggehen und beeilte sich, ihn wie ein Bittsteller anzusprechen. Als er sich dem hohen Herrn auf zwei Schritte genähert hatte, zog er die Uhr des Marquis von La Mole und hielt sie so, daß dieser sie sehen mußte.
»Folgen Sie mir von weitem!« sagte der Fürst, ohne ihn anzusehen.
Nach einer Viertelstunde betrat der Herzog ein kleines Restaurant.
In einem Stübchen dieses armseligen Lokals hatte Julian die Ehre, Seiner Durchlaucht die vier Seiten aufzusagen. Als er damit fertig war, sagte der Herzog: »Bitte, noch einmal und langsamer!«
Der Fürst machte sich Notizen.
»Gehen Sie zu Fuß zur nächsten Poststation. Lassen Sie Ihre Sachen und Ihren Wagen hier. Reisen Sie auf einem beliebigen Wege nach Straßburg, und am 22. dieses Monats (man schrieb den 10.) finden Sie sich um halb ein Uhr wieder hier in diesem Restaurant ein. Gehen Sie erst in einer halben Stunde und seien Sie schweigsam!«
Mehr bekam Julian nicht zu hören. Es genügte, um Julian mit der höchsten Bewunderung zu erfüllen. »Also so«, sagte er sich, »so wickeln sich Staatsaktionen ab! Was hätte der große Staatsmann wohl gesagt, wenn er die leidenschaftlichen Schwätzer von vorvorgestern mit angehört hätte?«
Julian brauchte zwei Tage, um nach Straßburg zu gelangen. Er machte einen Umweg. Er hatte ja Zeit.
Der Abbé Castanède, das Oberhaupt der Ordenspolizei an der Nordgrenze, hatte Julian zu seinem Glücke nicht erkannt. In Straßburg dachten die Jesuiten trotz ihres heiligen Eifers nicht daran, Julian zu beobachten. Er sah in seinem blauen Rocke mit der Ordensrosette ganz aus wie ein junger Offizier in Zivil, der sich nur mit sich selbst beschäftigte.
Gezwungen, acht Tage in Straßburg zu verweilen, suchte sich Julian in ruhmreiche kriegsgeschichtliche und vaterländische Erinnerungen zu vertiefen.
War er eigentlich verliebt?
Er wußte es nicht, aber das fühlte er in seiner Seelennot, daß Mathilde die Alleinherrscherin über seine Gemütsstimmung wie über seine Gedankenwelt war. Er hatte all seine Willenskraft nötig, um sich vor der Verzweiflung zu bewahren. An etwas zu denken, das in keiner Beziehung zu Fräulein von La Mole stand, war er nicht imstande. Ehedem, bei Frau von Rênal, hatten ihn seine ehrsüchtigen Träumereien und kleinen Eitelkeitserfolge dem reinen Zustand der Verliebtheit entzogen; Mathilde ließ nichts neben sich aufkommen. Wenn er in die Zukunft schaute, sah er immer nur sie. Und allerwegen in dieser Zukunft erblickte er Erfolglosigkeit. Er, der in Verrières voller Überhebung und Hochmut gewesen, war der lächerlichsten Bescheidenheit verfallen.
Noch vor drei Tagen hätte er den spionierenden Pfaffen am liebsten ermordet. Jetzt in Straßburg hätte er jedem Kinde recht gegeben, das in Streit mit ihm geraten wäre. Wenn er an die Widersacher und Feinde zurückdachte, die er im Laufe seines Lebens gehabt hatte, war es ihm, als hätte er – Julian – immer unrecht gehabt. An diesem Wandel seiner Selbstbeurteilung war einzig und allein der Umstand schuld, daß seine zügellose Einbildungskraft, die ihm bisher glänzende Zukunftsbilder vorgegaukelt hatte, mit einem Male zu seiner unversöhnlichen Feindin geworden war.
Die völlige Einsamkeit des Reiselebens machte seine verdüsterte Phantasie noch dunkler. Einen Freund bei sich zu haben wäre ihm ein Labsal gewesen. So aber sagte er sich: »Wo auf der Welt schlägt für mich ein Herz? Und selbst wenn ich einen Freund hätte, müßte ich als Ehrenmann schweigsam sein wie ein Grab.«
In seiner Melancholie machte er Spazierritte in die Umgegend von Kehl, einem Orte, der durch Desaix und Gouvion Saint-Cyr auf immerdar berühmt geworden ist. Ein deutscher Bauer zeigte ihm die Rheininseln und das Gelände, wo sich die Bravour jener großen Generale betätigt hatte. Die Zügel in der Linken, hielt Julian in der Rechten die vortreffliche Karte, die des Marschalls Saint-Cyr Denkwürdigkeiten schmückt. Plötzlich hörte er ein freudiges »Hallo!«.
Es war Fürst Korasoff, sein Londoner Freund, der ihn vor ein paar Monaten in die Anfangsgründe des höheren Dandytums eingeweiht hatte. Ganz im Sinne dieser erhabenen Kunst begann Korasoff, der seit gestern in Straßburg und seit einer Stunde in Kehl war und nie im Leben eine Zeile über die Belagerung von 1796 gelesen hatte, einen längeren Vortrag über dieses Ereignis zu halten. Der deutsche Bauer sah ihn verdutzt an, denn er verstand genug Französisch, um zu merken, daß der fremde Herr argen Unsinn vorbrachte. Julian freilich dachte himmelweit anders. Er betrachtete die Schönheit des jungen Mannes und bewunderte seine reiterliche Grazie.
Читать дальше