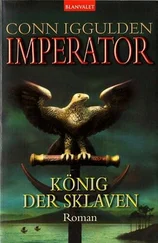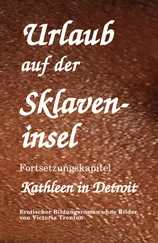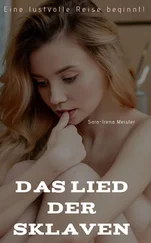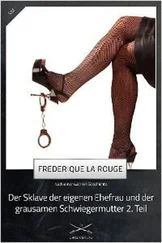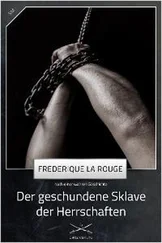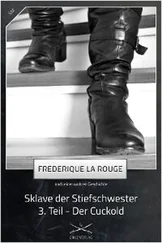Hebeisen musste weinen wie ein erwachsener Mann.
Ungerechtigkeit war etwas, das ihn immer beschäftigt hatte, schon als kleines Kind. Wahrscheinlich bestand sogar eine seiner ersten Lebenserfahrungen im Empfinden von Ungerechtigkeit, diesem lähmenden brennenden Schmerz, der sich früh mit seiner Sexualität verband und ihn fürs Leben prägen sollte. Er hatte eine Schwäche für die Schwachen. Er mochte es nicht, wenn Tiere gequält wurden. Er empfand eine Faszination für das unerträgliche Schicksal von Jesus, dem Gottessohn, der für den Rest der Menschheit am Kreuz gestorben war. Früh hatte es seine Beziehung zu Gott gestört, an den er deswegen irgendwann zu glauben aufgehört hatte. Er hatte Tom Sawyer bewundert, weil der in Mark Twains Erzählungen viel Schmerz in Kauf nahm, um die Mädchen vor den strafenden Lehrern zu beschützen, und geachtet hatte er immer auch dessen Kollegen Huckleberry Finn, weil der einen Schwarzen vor der Sklaverei bewahrte, indem er mit ihm auf dem Floss den Mississippi hinuntertrieb. «Der längste Tag» war ein Film, der ihn in der Seele demütigte. Er mochte es unerklärlicherweise, wenn in Römer- und Piratengeschichten Menschen ausgepeitscht wurden, aber er war nicht schwul. In der Bibelstunde, wohin ihn seine Eltern konsequent schickten, fand er Gefallen an der Geschichte mit Samson, dem sein Haar gestohlen wurde, und an der grausamen Salome, die den Kopf von Johannes, dem Täufer, forderte. Mückenstiche, die im Sommer seine Unterarme übermaserten, wurde er im Heimlichen nicht aufzureissen müde, bis sie im Herbst kleine dunkle Male bildeten. Wenn ihn die Mädchen an der Schule erniedrigten, zumal jene, die ihm gefielen, dann fühlte er sich jeweils ausser Stande sich zu wehren, was stets seine Unschuld erschütterte und ihn stark erregte. Die anderen Knaben misstrauten ihm, weil er schwächer war als sie und sich, um zu überleben, unmännlicher Spiesse bediente. Er glaubte an die weibliche Macht, und im Zweifelsfall war er mit seiner Mutter. Er wuchs auf im Schatten eines persönlichen Unheils, im Wissen um eine tödliche Achillesverse, von der die erwachsene Welt eine grössere Ahnung hatte als er selbst, weshalb Uneingeweihtsein seine Kinderseele marterte. Es trieb ihn in die Abhängigkeit von Älteren, die er hasste. Er litt unter Todessehnsucht. Es quälten ihn schwarze Gedanken. Christian Hebeisen war nie wirklich froh darüber gewesen, zur Welt gekommen zu sein.
Aufgewachsen war er in Rüti, in einer Industriegemeinde im Zürcher Oberland, wo die Familie Hebeisen im Haltbergquartier hinter dem Bahnhof ein grosses weisses Jugendstilhaus bewohnte, mit sandiger Zufahrt und beschattet von einem hohen dunkelgrünen Hain. Im Quartier gab es Fabrikantenvillen, Gewerkschaftsbüros, protestantische Freikirchen und ein paar provinzielle Night-Clubs. Am westlichen Ende genoss man die Aussicht auf die eindrückliche Bucht des Sulzer-Areals.
Dort, im zehnstöckigen blauen Verwaltungshochhaus hinter der steilen Bogenrampe mit Zahnradgleis, belegte der gelernte Ingenieur Heinz Hebeisen ein Büro. Als leitender Angestellter bezog er einen guten Zahltag. Beim Vater von Christian handelte es sich um einen klassischen Vertreter seiner Generation. Er verfügte über ein verzweigtes privates Beziehungsnetz und pflegte viele Freundschaften, auch solche aus dem Militärdienst. Zeit seines Lebens fuhr er viel Eisenbahn. Jedes Jahr leistete er sich ein Generalabonnement für die erste Klasse. Er hatte kurzes, schneeweisses Haar und trug stets gestreifte Hemden. Er war sportlich gealtert.
Heinz Hebeisen war verschlossen und zwanghaft. Jeden Morgen las er zu Hause den «Zürcher Oberländer» und in der Firma den «Blick». Er sprach mit einem eingetrockneten Weinen in der Stimme. Es handelte sich bei ihm um den steifen, unflexiblen Diskretionstyp, um den in Kindheit und Jugend brutalisierten Sensiblen letztlich, nämlich um den sogenannten Fascho, und damit ums typische Schweizerische Nachkriegsmodell. Über seinem Arbeitsplatz hing ein grosses Poster mit dem Matterhorn, Monika Kälin war eine Künstlerin, die er rundum bewunderte, und er war ein alter Fan des Fussballclubs Zürich. Seine Unterarme waren trocken und behaart, und er trug ein dünnes feminines Modell von Omega. Am Sonntag trank er seinen Milchkaffee aus einer grösseren Tasse als die restlichen Familienmitglieder, und in seinem Nachttisch, das erzählte er jedem, der es wissen wollte, lagerten seine Ordonanzpistole und zehn zugehörige Patronen. Heinz Hebeisen meinte, seine Familie damit vor gewalttätigen Einbrechern zu schützen. In Wahrheit verlieh es ihm die nötige Autorität nach innen.
Christian Hebeisen hasste seinen Vater.
Seit jeher schlug er eher nach der Mutter, nach Esther Hebeisen, wenn überhaupt, denn eigentlich glaubte bei Sohn Christian alle Welt an ein Kuckuckskind, so sehr tanzte er mit seinem introvertierten Wesen aus der Reihe.
Esther Hebeisen war gelernte Detailhändlerin. Sie hatte kurzes, kupferrotes Haar und trug eine unauffällige Brille mit Goldrand. Sie gefiel sich in jugendlichen Miniröcken, aber nach der Mode, und ihre laute Stimme war von einer Gepresstheit, die stets viel Frustration verriet. Sie war Gelegenheitsraucherin, aber nur auf der Arbeit und mit Kollegen, nämlich im quartiereigenen Usego-Laden.
Bis heute schätzte Christian Hebeisen an seiner Mutter ihr robustes Wesen und eine gewisse intellektuelle Aufgeschlossenheit, beispielsweise gegenüber den Lehren Rudolf Steiners. Menschen, die Esther Hebeisen nicht mochten, nannten sie deswegen ein Reibeisen oder eine Progressive im abschätzigen Sinne. «Extremeties» mit Farrah Fawcett-Majors in der Hauptrolle war ein Kinofilm, den sie liebte und den sie auf Video besass. Unter Feminismus verstand sie spätpubertäre weibliche Eitelkeit. Sie neigte zu Egoismus und zu Gefühlskälte, und in der Beziehung zu ihren Kindern machte sich eine grundsätzliche Ignoranz bemerkbar. Das schizophrene Verhalten gründete in der Verdrängung jenes Schmerzes, der ihr der Verzicht auf Identität verursachte. Dass es sich bei Esther Hebeisen in Wahrheit um eine Lesbe handelte, sollte in der herrschenden Provinzialität nämlich nie zu einem Thema werden. Aber sicher war es mit ein Grund, weshalb das Ehepaar mehrere Phasen der vorübergehenden Trennung durchlebte, in denen sich die Mutter selbst zu verwirklichen versuchte, unter anderem als Gründungsmitglied der kantonalzürcherischen POCH.
Christian Hebeisen hatte zwei ältere Geschwister: Susi und Dieter. Die Schwester sollte später Handarbeitslehrerin werden und im Ort unterrichten, der Bruder arbeitete heute als Lüftungszeichner bei Belimo.
Die Familie verreiste in Ferien ans holländische Meer, verbrachte ganze Sonntagnachmittage am Egelsee oder auf dem Hasenstrick, wo die Sportflugzeuge starteten und landeten. Im Spätsommer besuchte man jeweils den grossen Jahrmarkt mit seinen Karussells in Wetzikon. Es gab ein jährliches Quartierfest mit Bankett auf der gesperrten Strasse. Lampions am ersten August. Feuerwerk zu Sylvester. Mehr als einmal kam die Tour de Suisse und brachte Gratismützen und Flaggen aus Plastik.
Kaum waren die Hebeisens an die Haltbergstrasse gezogen, waren sie in eine Freikirche eingetreten. Mit den Gemeindemitgliedern pflegten sie auch privaten Umgang. Im Ort gab es eine Chrischona- und eine Pfingstgemeinde sowie methodistische und neuapostolische Kappellen. Christian Hebeisen mochte weder die Art von Kirche noch die zugehörigen Menschen. Früh war ihm sein Milieu zu eng, zu kleinkariert und zu bigott gewesen. Schon als Kind geriert er deswegen in den Ruf des Asozialen.
In der Volksschule, die er auf dem Schlossberg besuchte, zog er sich während der Pausen jeweils alleine auf die Bank am Aussichtspunkt zurück und genoss, derweil er schweigend sein Pausenbrot verzehrte, den Blick auf den Mürtschenstock, den Glärnisch, auf das Wäggital und den Etzel.
Читать дальше