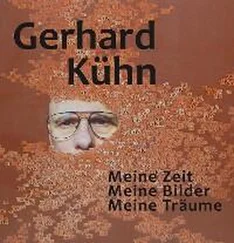Ich bedanke mich bei der Hrant Dink Stiftung für das Reisestipendium nach Eriwan während des Schreibprozesses für dieses Buch und beim Museum und Institut des armenischen Genozids in Eriwan für den herzlichen Empfang und die tatkräftige Unterstützung.
Meliha Meliha Dass Meliha Saraçoğlu tot war, bemerkten ihre Nachbarn einen Tag darauf. Seit ihr Mann Hamit Bey, Oberstleutnant a. D., pensionierter Bankdirektor und Veteran des Befreiungskrieges, vor zehn Jahren nach einem Herzinfarkt verschieden war, hatte Meliha Hanım allein gelebt. Als sie starb, war sie 79 Jahre alt. Sie hatte keine nahen Angehörigen, und falls doch, so waren diese niemals zu Besuch gekommen. Beigesetzt wurde sie von ihrer Gemeinde an einem regnerischen Tag nach dem Freitagsgebet. Es wurden Fürbitten gesprochen, man ging stumm zum Friedhof, und danach geriet Meliha Hanım wie alle Verstorbenen allmählich in Vergessenheit. Ihr Gesicht schwand aus dem Gedächtnis der Leute, so wie ihre Stimme es längst getan hatte. Als Meliha Saraçoğlu starb, war ich noch ein Kind. Erst Jahre später, als ich ihre schwarz-weißen Jugendfotos betrachtete, fiel mir auf, wie sehr wir einander ähnelten, und ich wurde von einer eigentümlichen Freude ergriffen. Dabei hatte Meliha Hanım gewiss kein erfreuliches Leben gehabt. Sonst hätte sie sich wohl kaum im Alter von 79 Jahren in ihrem Haus in Şişli, wo sie seit Jahren allein gelebt hatte, erhängt, und noch dazu ganz ohne Abschiedsbrief. Von Meliha Saraçoğlus Leben und von ihrem Tod erfuhr ich an ein und demselben Tag. Wie auch von einigen anderen Dingen, die ich bis dahin noch nicht gewusst hatte.
Istanbul?
Letzter Abend
Nach Jahren
Jacquelines neuester Coup
Eine Reise in die Vergangenheit
Landung
Vahans Geschichte
Weiterleben
Die Trauerfeier
Ach, mein Geliebter!
„Halte durch, mein Sohn! Es werden auch wieder gute Zeiten kommen“
Der Speicher
Die Bücher meines Vaters
Was ist der Mensch schon anderes als seine Erinnerungen?
Das Eis in uns
Trennung
Wahrheit
Lüge
Unnötiges
Das Foto
Zärtlichkeit
Belma
15. Juli 1983
Die Vergangenheit vergessen
Der Geruch
Das Haus
Erinnerungen
Die, die geblieben sind
Helligkeit
Sorgen
Ein Funke fällt
Nachrichten
Ein Mietshaus in Şişli
Ein Waisenkind
Die Geschichte
Die Stiftung
Das Haus
Eriwan
Das Archiv
Das Institut
Das Tagebuch
Das erste Heft
April
Nacht
Tag
Die Prophezeiung
Unterirdisch
Das zweite Heft
Namen
Orhan
Auswärtiger Dienst
Der Traum
Mündliche Prüfung
Jahre
Später
Schluss
Meliha
Glossar
Dass Meliha Saraçoğlu tot war, bemerkten ihre Nachbarn einen Tag darauf. Seit ihr Mann Hamit Bey, Oberstleutnant a. D., pensionierter Bankdirektor und Veteran des Befreiungskrieges, vor zehn Jahren nach einem Herzinfarkt verschieden war, hatte Meliha Hanım allein gelebt. Als sie starb, war sie 79 Jahre alt. Sie hatte keine nahen Angehörigen, und falls doch, so waren diese niemals zu Besuch gekommen. Beigesetzt wurde sie von ihrer Gemeinde an einem regnerischen Tag nach dem Freitagsgebet. Es wurden Fürbitten gesprochen, man ging stumm zum Friedhof, und danach geriet Meliha Hanım wie alle Verstorbenen allmählich in Vergessenheit. Ihr Gesicht schwand aus dem Gedächtnis der Leute, so wie ihre Stimme es längst getan hatte.
Als Meliha Saraçoğlu starb, war ich noch ein Kind. Erst Jahre später, als ich ihre schwarz-weißen Jugendfotos betrachtete, fiel mir auf, wie sehr wir einander ähnelten, und ich wurde von einer eigentümlichen Freude ergriffen. Dabei hatte Meliha Hanım gewiss kein erfreuliches Leben gehabt. Sonst hätte sie sich wohl kaum im Alter von 79 Jahren in ihrem Haus in Şişli, wo sie seit Jahren allein gelebt hatte, erhängt, und noch dazu ganz ohne Abschiedsbrief.
Von Meliha Saraçoğlus Leben und von ihrem Tod erfuhr ich an ein und demselben Tag. Wie auch von einigen anderen Dingen, die ich bis dahin noch nicht gewusst hatte.
„Warum ich?“, fragte ich. Eigentlich kannte ich die Antwort bereits: Was passiert war, war in Istanbul passiert, und bei der Pariser Zeitschrift, bei der ich während meines Studiums hospitiert hatte und wo ich inzwischen zur Korrespondentin befördert worden war, war ich die Einzige, die Türkisch konnte. Außerdem hieß ich Derin, war also für die anderen naturgemäß immer noch mehr Türkin als Französin.
Insgeheim aber ärgerte es mich, dass ein Ort, an den ich seit Jahren keinen Fuß mehr gesetzt hatte, nach wie vor als meine „Heimat“ angesehen wurde. Außerdem hatte ich von dem Journalisten, der dort ermordet worden war, nie zuvor gehört. Ich kannte überhaupt nur eine Handvoll Armenier, und das waren alles berufliche Kontakte aus Paris. Mit einem hatte ich ein Interview über sein neues Album geführt; er konnte sich partout meinen Namen nicht merken, aber dazu war er natürlich auch viel zu berühmt. Immerhin hatte er an meiner Hautfarbe und meinen schwarzen Locken erkannt, dass ich keine typische Französin war, und mich gefragt, ob ich Maghrebinerin sei. Als ich mit einem schlichten „Nein“ antwortete, ließ er das Thema auf sich beruhen. Ein anderer war ein recht gutaussehender, sehr von sich eingenommener junger Mann gewesen, der damals gerade für den Bürgermeisterposten eines Pariser Vororts kandidierte. Ich hatte ihn auf einer Konferenz kennengelernt und gleich wieder vergessen. Als er dann seine Wahlkampagne startete, warf unsere Redakteurin die Idee in den Raum, eine Titelstory daraus zu machen, und eine Stimme von der anderen Seite des Tisches sagte: „Derin kennt ihn schon, sie waren beide beim Mittelmeerforum in Marseille.“ Das kam natürlich von Emmanuelle, die zwar ständig ihre Haarfarbe, ihren Kleidungsstil, ihre Freunde und ihre Interessen wechselte, ihre Taktlosigkeit aber konsequent beibehielt und dafür jetzt wütend von mir angefunkelt wurde. Sie war neu im Team, hatte nach ihrem Uni Abschluss erst ein Verlagspraktikum absolviert und war dann zur Selbstfindung in eine der französischen Überseekolonien gegangen. Nachdem sie wieder zurückgekehrt war, hatte ihre Mutter, die überall ihre Finger im Spiel hatte, ihr die Stelle bei uns besorgt.
Während mir das alles durch den Kopf schoss, überlegte ich, wie ich den Trip nach Istanbul auf jemand anderen abwälzen könnte. Plötzlich bei einer Beerdigung aufzukreuzen, wo ich doch meine Beziehungen zu Armeniern auf ein Mindestmaß zu beschränken versuchte, und dazu auch noch in eine Stadt zu reisen, mit der mich nichts verband, außer ein paar Leuten, die Kinderfotos auf Facebook stellten und mich darin markierten, obwohl ich sie seit Jahren nicht mehr gesehen hatte und mich nur noch schemenhaft an sie erinnerte – das war so ziemlich das Letzte, was ich wollte. „Warum ich?“, fragte ich also, was eine verkürzte Version von dem war, was ich eigentlich gern gefragt hätte, nämlich: „Mein Gott, wieso halst ihr mir das auf? Bin ich hier die Armenologin vom Dienst, oder was?“
„Weil du die Einzige bist, die Türkisch kann“, platzte es wie üblich aus Emmanuelle heraus. Während unsere Redakteurin eine huldvoll kreisende Bewegung mit der Hand vollführte, die wohl bedeuten sollte: „Bitte, da hast du deine Antwort“, ging mir bloß das türkische Wort für „Plappermaul“ durch den Kopf: Zevzek !
Während ich meine Sachen packte, überhäufte mich meine Mutter mit guten Ratschlägen, was ich in Istanbul tun solle und was nicht. Unvorbereitet, wie ich war, würde ich morgen früh an einen Ort fliegen, der mir völlig fremd geworden war, auch wenn dort immer noch mein Vater begraben lag. Worin vielleicht der einzige Reiz an meinem Flug nach Istanbul lag: Zum ersten Mal würde ich sein Grab besuchen. Es war, als könnte ich nach Jahren wieder zu dem Moment zurückkehren, in dem er uns verlassen hatte, als könnte ich ihn umarmen, mit ihm sprechen, wieder sein kleines Mädchen sein.
Читать дальше