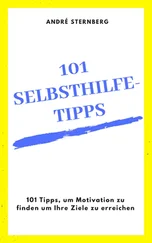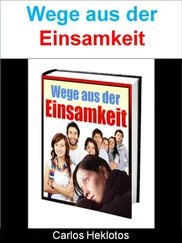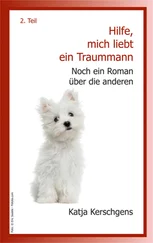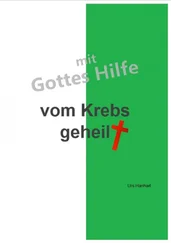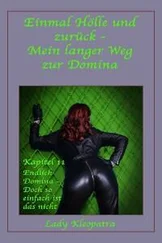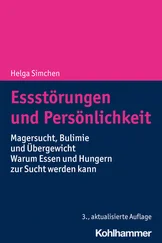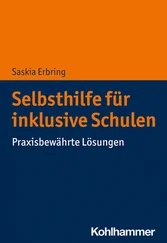b) Im Bereich des Verhaltens
• Innere und äußere Unruhe
• Gefühlsschwankungen mit Impulssteuerungsschwäche
• Selbstwertproblematik mit innerer Verunsicherung
• Soziale Konflikte infolge beeinträchtigter Verhaltenssteuerung
• Unüberlegtes und spontanes Handeln
• Negativer Dauerstress bei niedriger Frustrationstoleranz
• Der Antrieb ist extrem gesteigert oder reduziert
c) Im Bereich der motorischen Fähigkeiten
• Ständiger Bewegungsdrang
• Defizite in der Grob- und Feinmotorik
• Koordinationsprobleme einzelner Muskelbereiche, die Sprache, Schrift und Sehfähigkeit betreffen können
d) Als mögliche Folgen der o. g. Probleme:
• Selbstwertproblematik
• Sozialer Reiferückstand
• Pubertätskrisen
• Teilleistungsstörungen
• Angst- und Zwangsstörungen
• Suchtentwicklung
• Depressive Verstimmungen
• Essstörungen
Um diese Symptome zu erkennen, ist folgendes Diagnoseschema zu empfehlen, was von mir in der Praxis seit vielen Jahren erfolgreich verwendet wird und sich besonders für die Diagnostik des ADS ohne Hyperaktivität im Kindes- und Jugendalter bewährt hat. Denn diese Betroffenen werden noch immer viel zu oft nicht erkannt oder für depressiv gehalten und dann mit entsprechenden Medikamenten behandelt.

Abb. 1.1: Diagnoseschema des AD(H)S bei Kindern und Jugendlichen
Das AD(H)S wächst sich nicht aus, es kann aber mit zunehmendem Alter sein Erscheinungsbild ändern, z. B. werden die nach außen gerichtete Hyperaktivität und die motorischen Auffälligkeiten dann meist geringer.
Allen Altersstufen gemeinsam sind bei AD(H)S folgende neurobiologisch bedingte Funktionsstörungen, die je nach Schwere des Betroffenseins unterschiedlich ausgeprägt sein können:
• Mangelhafte Automatisierung der kognitiven Abläufe zwischen Arbeits- und Langzeitgedächtnis
• Sich nicht konzentrieren können
• Die Daueraufmerksamkeit konstant aufrecht zu halten
• Eine ständige innere Unruhe und viele Gedanken im Kopf
• Schlechte Merkfähigkeit, Vergesslichkeit
• Probleme in der Gefühlssteuerung
• Innere Verunsicherung mit Selbstbeschuldigungen bei schlechtem Selbstwertgefühl
• Mangelnde Fähigkeit, sich sozial angepasst zu verteidigen
• Probleme, sich zu entscheiden
• Schlechtes Zeitgefühl
• Überempfindlichkeit gegenüber Stress
• Beeinträchtigungen in der feinmotorischen Abstimmung und in der Koordination
Hieraus ergeben sich die Schwerpunkte der Behandlung von AD(H)S. Dabei ist es wichtig, dass die Betroffenen wissen, warum sie so sind und was sie selbst ganz konkret dagegen tun können. Sie müssen die Ursache ihres Verhaltens verstehen und begreifen, damit Hilflosigkeit mit innerer Verunsicherung und Selbstverachtung gar nicht erst aufkommen. Deshalb kann nur eine mehrdimensionale Behandlung den Lebenslauf und die Lebensqualität dauerhaft verbessern und ist bei einem ausgeprägten AD(H)S unbedingt erforderlich.
Für AD(H)S-Kinder besteht das Hauptproblem darin, sich nicht konzentrieren können. Sollen beispielsweise in einer Freistunde Hausaufgaben gemacht werden, tritt diese Schwierigkeit im besonderen Maße zutage. Das Ergebnis sieht dann häufig entsprechend aus (  Abb. 1.2).
Abb. 1.2).
Abb. 1.2: Beispiel einer Hausaufgabe eines 11-jährigen ADHS-Kindes
1.4 Probleme bewältigen durch aktive Mitarbeit mit individuellen Strategien
An sich zu arbeiten, damit kann jeder sofort beginnen, auch wenn er (noch) kein diagnostiziertes AD(H)S, aber ähnliche Probleme hat – vielleicht bei einer entsprechenden Veranlagung oder wenn die Diagnostik noch aussteht, um die Zeit sofort für sich positiv zu nutzen. Die Anwendung gezielter Lern- und Verhaltensstrategien ist für alle – Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen – hilfreich, sie wird von vielen schon täglich erfolgreich praktiziert und ist gar nicht so schwer, wie es anfangs scheinen mag. Haben sich diese Vorgehensweisen nach mehrfachem Üben erst einmal automatisiert, d. h. verselbständigt, sind sie viel weniger anstrengend.
Im Folgenden gebe ich einen Überblick über in der Praxis bewährte Erziehungsstrategien, die Schwierigkeiten in allen Leistungs- und Verhaltensbereichen wirkungsvoll reduzieren.
Strategie Nr. 1: Tages- und Wochenstruktur und Tages-/Wochenplan einführen
• Beginnen mit einer Aufgliederung des Tagesablaufs und der Zuordnung von Tätigkeiten
• Eine Liste anfertigen von den Aufgaben bzw. Arbeiten, die heute unbedingt erledigt werden müssen
• Einen Wochenplan für alle wichtigen Aufgaben machen und diesen möglichst einhalten
• Klare Ziele definieren, die in dieser Woche auch erreichbar sind und wenn erledigt, dann abhaken
• Täglich schriftlich seine Erfolge kurz notieren
• Positive Abendreflexion im Familienkreis, wo jeder kurz über das spricht, was er heute gut gemacht und erledigt hat und was unbedingt noch morgen zu erledigen ist
• Mit Disziplin, Selbstvertrauen und viel Lob sich immer wieder motivieren, den Tagesplan auch einzuhalten
• Sein Verhalten und seine Leistungen versuchen, realistisch zu beurteilen
• Bei Konflikten nach Lösungswegen und Vermeidungsstrategien suchen
• Sich in der Familie um eine warmherzige und vertrauensvolle Atmosphäre bemühen
• Keine Vorwürfe dulden, keine Beschuldigungen, aber Kritik annehmen und Selbstkritik üben
• Seine Vorsätze ständig aktualisieren und schriftlich formulieren
• Den Terminkalender in der Familie miteinander abgleichen
Strategie Nr. 2: Konzentration verbessern
• Für Ruhe sorgen, Reizüberflutung vermeiden
• Eine Aufgabe möglichst mit konkreter Zeitvorgabe angehen
• Keine Störung zulassen, Handy und Medien ausschalten
• Sich innerlich auf diese Aufgabe einstellen
• Sich befehlen: »Ich muss mich jetzt konzentrieren« (wichtigste Selbstinstruktion!), keine anderen Gedanken zulassen
• Keine überflüssigen Dinge auf dem Arbeitstisch, die ablenken
• Nach Erledigung sich loben und eine zeitlich festgelegte Pause machen
Diese Strategien aufgabenbezogen mehrmals täglich wiederholen, Schwierigkeitsgrad und Dauer der Aufgabe allmählich erhöhen.
Strategie Nr. 3: Umgang mit unruhigen und verhaltensauffälligen Kindern
• Als Eltern selbst immer Ruhe bewahren
• Eindeutige Regeln von Anfang an schriftlich festlegen und einhalten, keine Ausnahme dulden! Einmal Ausnahme ist immer Ausnahme!
• Alle unnötigen Reize aus der Umgebung vermeiden, sonst kann sich das Kind nicht konzentrieren und wird ständig abgelenkt
• Das Kind konsequent, aber liebevoll ohne emotional spürbare Erregung führen
• Wer sich aufregt provoziert das Kind, es reagiert mit Stress, was die Situation verschärft und endlose Diskussionen auslösen kann, auf die man sich nicht einlassen sollte
• Zuwendung durch Blick- und Körperkontakt signalisieren
• Viel Bewegung zulassen, Bewegungsspiele kurz einbauen
• Abwarten und Beenden einer Tätigkeit zuerst mit Hilfe von Spielen üben
• Abwarten und eine Belohnung aufschieben können, sollte zeitig gelernt werden
• Rituale einführen, sie erleichtern den Umgang
• Selbständigkeit fördern und auch einfordern, nur Anleitungen dazu geben
• Kurze Spiel- und Arbeitszeiten mit Steigerung von Dauer und Schweregrad
Читать дальше
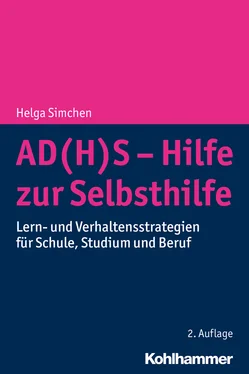

 Abb. 1.2).
Abb. 1.2).