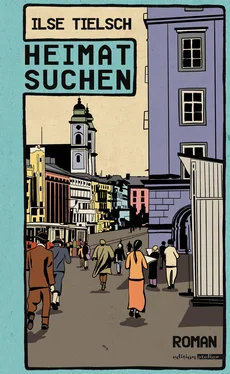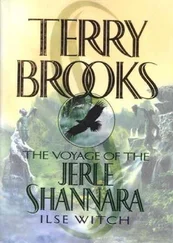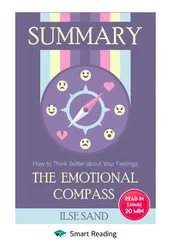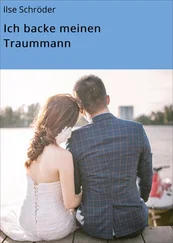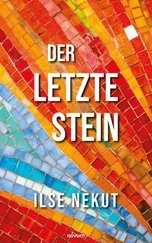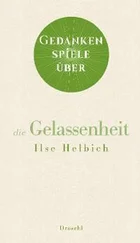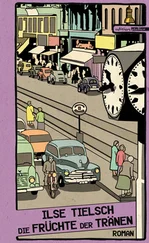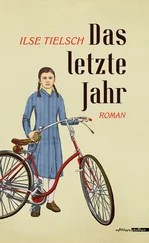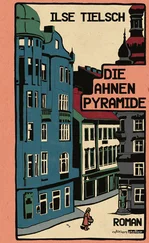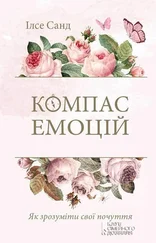Sie tranken alle von dem mit dem Schnaps gemischten Bachwasser, auch die Kinder tranken davon. (Wir sind nicht krank davon geworden, sagt die Mutter, es ist ein sehr starker Schnaps gewesen, er hat das Wasser wahrscheinlich desinfiziert.)
Nachdem sie getrunken hatten, kramten sie hervor, was sie an Eßbarem hatten. Ein Stück Brot, ein Stückchen Speck, dann suchte jeder für sich eine Stelle am Bach, wo er sich, ungesehen von den anderen seiner Kleidung entledigen und waschen konnte.
Dann saßen sie wieder unschlüssig im Gras, konnten sich nicht dazu aufraffen, aufzustehen und weiterzugehen. Während des ganzen, mehr als zwanzig Kilometer langen Fußmarsches hatten sie Angst gehabt. Es war eine Folge dieser Angst gewesen, daß sie, trotzdem sie Papiere mit der amtlichen Bewilligung zum Grenzübertritt in der Tasche trugen, nicht den offiziellen Grenzübergang gewählt, sondern heimlich den Grenzbach und seine sumpfigen Ufer durchwatet hatten. Jetzt, da sie die Landesgrenze im Rücken wußten, hätte es eigentlich keinen Grund mehr zur Furcht gegeben. Trotz dieser Gewißheit jedoch, trotz des befreienden Gefühls, ENDLICH AUF ÖSTERREICHISCHEM GEBIET zu sein, wurden sie diese Angst nicht los, sie hatten sich zu sehr an sie gewöhnt.
Dazu, sagt die Mutter, sei dieses schreckliche Gefühl gekommen, ZUM BETTLER geworden zu sein, von Haus zu Haus gehen, um ein vorübergehendes Obdach, um etwas Nahrung bitten zu müssen. Ihr Ziel sei ja Wien gewesen, dort hätte jeder von ihnen Verwandte, wenigstens Bekannte aus besseren Tagen gehabt.
Aber bis Wien sei es noch weit gewesen.
Schließlich habe sich ein Bauernwagen auf sie zubewegt, ein Bauer aus dem nächstgelegenen Dorf sei unterwegs gewesen, um Klee zu holen. Heinrich hat die Begegnung mit dem Bauern in einem Notizbuch beschrieben: ER ERKLÄRTE SICH DAZU BEREIT, UNS BEI SICH AUFZUNEHMEN, VORSICHT SEI ABER GEBOTEN, DA IM DORF DIE RUSSEN SEIEN. ER WÜRDE JETZT NACH HAUSE FAHREN, DEN KLEE ABLADEN UND NOCHMALS ZURÜCKKOMMEN. DANN SOLLTEN WIR UNSER GEPÄCK AUF DEN WAGEN GEBEN, ER WÜRDE KLEE DARÜBER BREITEN UND ZU SEINEM HOF FAHREN. WIR SOLLTEN IHM IN GRÖSSEREM ABSTAND FOLGEN. SO GESCHAH ES DANN AUCH.
Heinrich, an Wundrascheks Entlohnung denkend, bot dem Bauern das einzige Stück von einigem Wert an, das Valerie gewagt hatte, in ihrer Handtasche mitzunehmen, eine silberne Puderdose. Der Bauer wies die angebotene Gabe zurück, er wollte für seine Hilfe keinen Lohn. (Das werde ich nie vergessen, sagt die Mutter.)
Sie trotteten hinter dem Kleewagen nach, jenen Feldweg entlang, der sich, hellbraun, mit einem Stich ins Graue, zwei Fahrspuren, in der Mitte eine mit Erdstaub bedeckte Rinne, vom Grenzbach weg, zwischen Weizen- und Rübenfeldern, in Richtung des Dorfes Ottenthal im niederösterreichischen Weinviertel hinzog. (Es ist der gleiche Feldweg gewesen, den ich, Anna, auf der im Juni des Jahres 1981 entstandenen Farbfotografie wiederfinde.)
ES SIND GUTE LEUTE GEWESEN, sagt die Mutter.
Die Bäuerin schlug Eier in eine Pfanne, gab ihnen ein Stück Brot dazu. Die Männer durften in der Scheune schlafen, Frauen und Kindern wurden zwei aneinandergeschobene Betten als Nachtlager angewiesen. Ob es ihnen etwas ausmache, daß in dem Bettzeug die Russen geschlafen hätten? Nein, es machte ihnen nichts aus.
Sie blieben mehrere Tage, arbeiteten auf den Feldern, wurden dafür, soweit dies möglich war, mit Nahrung belohnt.
Heinrich operierte eine Frau, die einen Abszeß im Hals hatte, mit seinem Taschenmesser. Der für den Ort zuständige Arzt war vor der heranrückenden Front in den Westen geflüchtet.
Vielleicht hätten sie bleiben können, da der Ort ohne ärztliche Versorgung war, aber sie entschlossen sich weiterzuziehen. Ihr Gepäck ließen sie zurück. Sie gingen nach Mistelbach, übernachteten in einem Zimmer des Krankenhauses, wurden von dem für das Gebiet verantwortlichen ärztlichen Leiter nach Stronsdorf verwiesen.
Auf der Landkarte, die vor mir auf dem Schreibtisch liegt, sind die Entfernungen zwischen den an der Hauptstraße gelegenen Orten angegeben. Auch wenn ich die Möglichkeit von Abkürzungen über Feldwege in Erwägung ziehe, ist für den Weg von Ottenthal nach dem Städtchen Mistelbach eine Entfernung von rund dreißig Kilometern anzunehmen, von dort über Eichenbrunn nach Stronsdorf werden es wieder etwa fünfundzwanzig Kilometer gewesen sein. DAS ALLES ZU FUSS, sagt die Mutter.
Sie gingen hügelauf, hügelab, zwischen Feldern, an kleinen Wäldchen vorbei, an Obstbäumen, die vom Wind alle in die gleiche Richtung gezaust waren.
In Stronsdorf sei DER GANZE PLATZ VOLLER RUSSEN gewesen. Hier bleibe ich nicht, sagte Valerie.
(Der Marktplatz von Stronsdorf, auf dem die vielen russischen Soldaten gelagert haben, ist auf mehreren, im Juni 1981 entstandenen Fotografien zu sehen. Es ist ein großer, kahl wirkender, heute beinahe zur Gänze asphaltierter oder betonierter Platz, von niedrigen Häusern gesäumt, die eine Seite abgeschlossen durch einen Gasthof mit glatt verputzter Fassade, auf der anderen Seite eine Mariensäule, umgeben von Grün. Schwierig, sich vorzustellen, wie dieser heute friedlich wirkende Platz damals ausgesehen hat, nicht schwierig, die Angst nachzuempfinden, die Valerie beim Anblick der vielen russischen Soldaten überkam, ihre entschiedene Weigerung, in das heute noch unveränderte Arzthaus einzuziehen, obwohl ihr das angeboten worden ist.
Auch dieser Arzt war geflüchtet, auch die Bewohner von Stronsdorf waren ohne ärztliche Betreuung geblieben. Zwei alte Frauen, auf dem Weg zur Andacht in die wuchtige Pfarrkirche, zu der mehrere Steinstufen hinaufführen, erinnern sich: Ja, damals sei es furchtbar gewesen. Sie seien mit ihren Kindern alle UNTER DER KIRCHE gewesen. Nein, nicht möglich, das zu vergessen. Aber man habe es ja überstanden. Gott sei Dank.)
Heinrich und Valerie waren von dem ärztlichen Leiter des Mistelbacher Krankenhauses an eine bestimmte Adresse verwiesen worden, hatten das Haus gefunden, an die Tür geklopft, warteten. Endlich wurde die Tür einen Spaltbreit geöffnet, sie wurden nach ihren Wünschen gefragt. Heinrich nannte den Namen des Arztes in Mistelbach. Längeres Zögern, schließlich schob eine Hand die Sicherheitskette zurück, eine alte Frau öffnete die Tür, bat einzutreten, schloß sofort wieder ab, legte die Kette vor. (Man habe erkennen können, daß die Bewohner des Ortes in ständiger Angst gewesen seien.)
Sie wurden in ein Zimmer mit alten Möbeln geführt, mit Tee bewirtet, durften sich ausruhen, ein wenig schlafen, wurden dann an den Bürgermeister verwiesen, dort freundlich aufgenommen, zum Haus des Arztes gebracht. Obwohl das Haus zur Gänze eingerichtet, alles Notwendige vorhanden war, obwohl sie von der Frau des geflüchteten Arztes gebeten wurden, zu bleiben, beharrte Valerie auf ihrer Weigerung.
Hier bleibe sie nicht einen Tag länger, sagte sie.
Zurück nach Mistelbach, sagt die Mutter, sie seien an einer Schlucht vorbeigekommen, seien so erschöpft, so mutlos, traurig gewesen, daß sie nahe daran gewesen seien, in die Schlucht zu springen.
SPRINGEN WIR, soll der Vater gesagt haben. Da habe ihn Valerie an die Tochter Anni erinnert, die vielleicht noch am Leben sei. Daraufhin hätten sie einander an der Hand genommen und seien weitergegangen. Unterwegs habe ein russisches Lastauto angehalten, der Fahrer habe sie bis knapp vor Mistelbach mitgenommen. Das Lastauto habe junge Zwiebeln geladen gehabt, ihr Kleid und ihre Unterwäsche, sagt die Mutter, seien ganz grün von den Zwiebeln gewesen.
In Mistelbach habe man ihnen einen anderen Ort genannt, dessen Arzt ebenfalls geflüchtet war, sie gingen weiter bis dorthin, es waren nur wenige Kilometer, sie seien es schon so gewöhnt gewesen, zu gehen und zu gehen, im Traum, sagt die Mutter, habe sie noch ihre Füße bewegt.
Ich, Anna, suche das Dorf W. südlich von Mistelbach auf der Landkarte, in dem sie schließlich für längere Zeit geblieben sind. Die Frau eines Schusters nahm sie auf, sie lebte mit ihrer Schwiegermutter, Frau O., im gemeinsamen Haushalt, der Schuster war noch nicht wieder heimgekehrt, man hatte keine Nachricht von ihm, sein letzter Feldpostbrief war aus Rußland gekommen.
Читать дальше