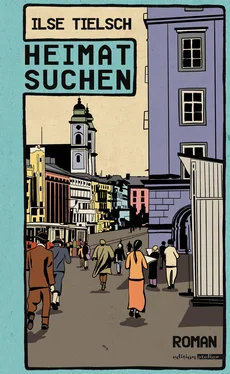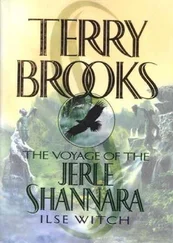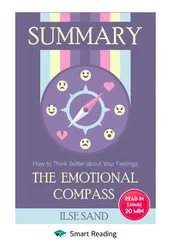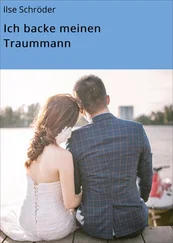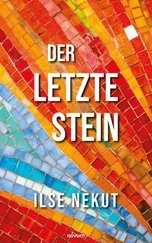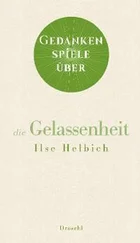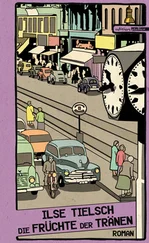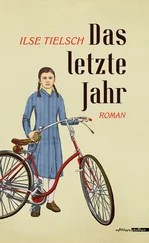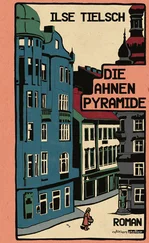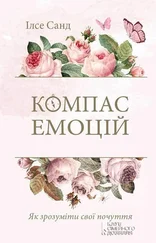(Welchen Kreisen haben die Damen angehört, die damals KLEIDER MIT BLUSIGEM RÜCKEN trugen, für den Nachmittag mit Valenciennes-Spitzen besetzt oder mit aufgenähten Stoffblumen verziert? Wer konnte sich jene Abendkleider leisten, die SPARSAMER ALS BISHER DIE REIZE SCHÖNER FRAUEN zeigten, die vorne hochgeschlossen, dafür am Rücken tief dekolletiert waren, BEVORZUGTE MATERIALIEN: BROKAT, TÜLL UND TAFT?
SEID GETROST, FRAUEN, schreibt der Verfasser des Modeartikels im WIENER KURIER, auch für euch wird bald die Zeit kommen, da ihr in beschränktem Ausmaß wieder einkaufen könnt!
Wer konnte die vielen aus Loden, aus Wolle, aus Seide und Brokat gefertigten Trachtenmodelle kaufen?
EINES STEHT FEST, hieß es, DIE RÖCKE WERDEN WEITER. Unter dieser Notiz, klein gedruckt, ein Hinweis: WIENER AUFGEPASST! ALLE VERBRAUCHER ÜBER 12 JAHRE ERHALTEN AUF ABSCHNITT M DER BROTKARTE 70 DEKA BROT!
Valerie besaß einen Rock, zwei Blusen, eine Strickjacke und ein vor Jahren in Bad Goisern von einem Schneider angefertigtes, jetzt an den Kanten schon abgewetztes Lodenkostüm. Andere allerdings hatten nicht einmal das. Heinrich hatte drei Hemden über die Grenze gebracht, es gab keine Waschmittel, Valerie hatte diese Hemden mit reinem Wasser auszuwaschen, ein bißchen Seife auf Kragen und Manschetten, dann hängte sie die Hemden im Hof zum Trocknen auf, zog sie zurecht, ein Bügeleisen hatte sie nicht.
Wir waren so arm, sagt die Mutter, daß sich das heute niemand mehr vorstellen kann.)
Der Tag, an dem Valerie zum zweitenmal das Nachbarhaus betrat, aus irgendeinem Grund, an den sie sich nicht mehr erinnert, nach der Bäuerin rief, keine Antwort erhielt, bis sie durch das Vorhaus weiterging, in den Hof. Valerie stand wie erstarrt, sie konnte nicht glauben, was sie da sah. Quer über den Hof waren, von einer Mauer zur anderen, Wäscheleinen gespannt. Aber an diesen Leinen waren nicht etwa Hemden, Socken oder Unterhosen des Bauern, der Bäuerin, ihrer Kinder, nein, da waren Herrenanzüge befestigt, sichtlich von guten Herrenschneidern gearbeitet, Damenkleider verschiedenster Machart, aus Wollstoff, aus Seide, ein Abendkleid, das keineswegs der kurzbeinigen Bäuerin gehören konnte, spitzenbesetzte Nachthemden hingen da und ein Morgenmantel aus Samt. Vor allem aber hingen, über die Wäscheleine geworfen, die Wäscheleine schwer belastend, eine Herausforderung für die Augen, zwei Damenpelzmäntel und ein Herrenwintermantel mit Innenfell.
Valerie stand bewegungslos, sie hätte sich gar nicht bewegen können, auch wenn sie die Absicht gehabt hätte. Sie sah die Bäuerin und eine Nachbarsfrau geschäftig hin- und herlaufen, weitere Wäschestücke, Kleider aus großen Kisten nehmen, über die Stricke werfen. So versunken waren die beiden in ihre Beschäftigung, so von ihr in Anspruch genommen, daß sie in ihrem Eifer die ungebetene Augenzeugin nicht bemerkten.
Valerie verfolgte ihre Bewegungen mit den Augen, registrierte: ein Sommerkleid, zweifarbig, mit Rüschen besetzt, ein roter Seidenrock, weiß getupft, eine Jacke aus Wollstoff, eine Seidenbluse. Wem immer dies alles gehören mochte, es war, nach immerhin siebenjähriger Kriegszeit mit Kleiderkarten und Bezugsscheinen, die man nur selten bekam, eine märchenhafte Garderobe.
Dann, endlich, blieben ihre Augen an einem braunledernen Gegenstand hängen, der in einer Ecke des Hofes auf dem Boden lag. Valerie stellte sofort aus der Entfernung fest, daß es sich nur um den zweiten, den fehlenden Schuh handeln konnte, ging hin, konstatierte, daß ihre Vermutung richtig gewesen war, hob den Schuh auf und hielt ihn noch in der Hand, als sich, in diesem Augenblick, die Bäuerin zu ihr umwandte.
Bilder, die unvergessen geblieben sind, die jetzt von der Mutter geschildert werden: das vor Schreck und Entsetzen verzerrte Gesicht der Bäuerin, ihre gestikulierenden Hände, mit denen sie Erklärungen zu unterstreichen versucht. Die mit hilflos herabhängenden Armen dabeistehende, ebenfalls erschrockene Nachbarsfrau. Die Wäschestücke, die im aufkommenden Herbstwind zu flattern beginnen, ein Wäschestück, das sich losreißt, von der Leine löst, in den Zweigen des breitästigen Nußbaumes hängenbleibt. Diese Sachen, erklärte die Bäuerin, fast schreiend vor schlechtem Gewissen, habe ihr jemand zur Aufbewahrung übergeben, sie seien im Hauskeller versteckt gewesen, hätten durch die Feuchtigkeit einen üblen Geruch bekommen, sie hätte das festgestellt und gefunden, daß man sie dringend lüften müsse.
Eine Pause entstand, gefährliches Schweigen hing in der blauen Herbstluft, Valerie stand immer noch unbeweglich, bis die Frau schließlich keifend erklärte, der Besitzer dieser Sachen käme sicherlich niemals wieder. Wenn er die Absicht gehabt hätte, wiederzukommen, oder vielmehr die Möglichkeit dazu, dann hätte er sich längst gemeldet, wenigstens seine Frau. Wahrscheinlich, fügte sie hinzu, seien die beiden längst tot.
Sie nannte den Namen des Mannes, der ihr die Kisten anvertraut hatte, und Valerie erstarrte zum zweitenmal. Sie hatte einen Namen gehört, den sie kannte. Sie drückte den Schuh an die Brust und verließ mit raschen Schritten das Haus.
Hier müssen familiäre Bezüge ins Gedächtnis gerufen werden.
Eine schon einmal in B. vom Vater auf ein Blatt Papier gezeichnete, im zweiten Teil seines Lebens mühsam rekonstruierte, aus rechteckigen Kästchen gefügte Pyramide muß aus der Schreibtischlade geholt, in den Lichtkreis der Lampe gebracht, betrachtet werden.
Annis Name im untersten Kästchen, rechts und links über ihrem Namen die Namen der Eltern, Heinrich und Valerie.
Schräg aufwärtsgezeichnete Linien führen zu Valeries Eltern Josef und Anna, zu Heinrichs Eltern Friederike und Adalbert, dann, darübergelagert, zum oberen Blattrand aufsteigend, sich verzweigend, in ungleich langen Ausläufern endend, der große, übrige Teil der Pyramide, Namen und Namen, die einmal zu Menschen gehörten, deren Gesichter nur noch vereinzelt auf alten Fotografien festgehalten, deren Schicksale nur noch zum Teil überliefert sind. Ihre Lebensläufe, ihr Glück und ihr Unglück, die Lichtpunkte und die tragischen Verkettungen, alles, was über sie in Erfahrung zu bringen war, ist schon einmal beschrieben worden. Trotzdem muß zurückgeblickt, angeknüpft werden, wo damals nicht fortgesetzt worden ist. Der Vater hat unter dem Namen seiner Mutter Friederike auch die Namen ihrer Geschwister eingetragen: Helene, Marie und Hermann. An Helenes Namen bleiben die Augen hängen. Sie war, nach kurzer Ehe mit einem Mann, der Postmeister und Stationsvorstand der Mariazellerbahn in einer kleinen niederösterreichischen Stadt bei Sankt Pölten gewesen ist, wieder geschieden worden, mußte den Sohn seinem Vater überlassen, zog nach Wien, der Sohn wurde vom Vater erzogen, ein wahrscheinlich nicht sehr glückliches Kind, in dessen Gegenwart der Name der Mutter nicht ausgesprochen worden ist, das die Mutter nicht sehen durfte, das, als es älter wurde, wahrscheinlich von jenem furchtbaren Verbrechen erfahren hat, welches die Mutter begangen hatte: Sie hatte sich, jung, schön, lebenslustig, von ihrem Mann vernachlässigt, in den Gemeindearzt verliebt. Ihr Sohn Hans war der erste der Blutsverwandten, den Heinrich damals in W. bei Mistelbach wiedergesehen hat.
Es ist anzunehmen, daß die Abneigung, welche die beiden Vettern füreinander empfanden, auf beiden Seiten gleich stark gewesen ist. Heinrich, schon als junger Mensch eher schwächlich, sensibel, musikalisch, Hans, dessen politische Karriere mit dem Einmarsch der deutschen Truppen in Österreich begann, da war kein Raum für ein längeres Gespräch, da konnte man sich auch aus Gründen verwandtschaftlicher Beziehung nicht füreinander erwärmen. Kaum denkbar jedenfalls, daß sich Heinrich, wäre der andere in seiner Situation gewesen, ähnlich verhalten hätte, wie Hans sich verhielt.
Ich, Anna, versuche mir vorzustellen, wie die von der Mutter mehrfach geschilderte Begegnung der Vettern damals, im Herbst 1945, verlaufen ist.
Читать дальше