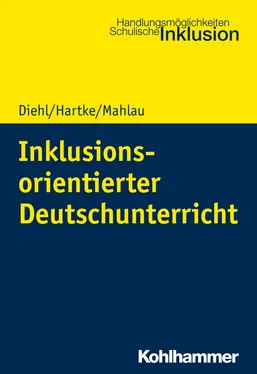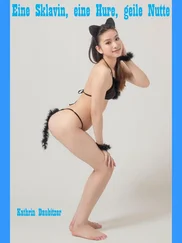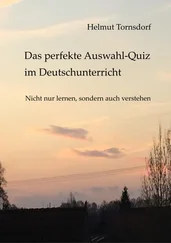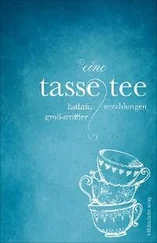Notwendig für das Verständnis eines Textes sind sowohl Prozesse der Worterkennung bzw. des Wortverstehens als auch des Satzverständnisses. Darüber hinaus verlangt das Erfassen des Sinns eines Textes eine Unterscheidung von zentralen und weniger bedeutsamen Inhalten der gelesenen Sätze sowie eine Zusammenschau der wesentlichen Aussagen und deren Beziehung zueinander. Wie oben bereits beschrieben unterscheidet Lenhard (2013) in seinem Situationsmodell des Leseverständnisses hierarchiehohe und hierarchieniedere Prozesse, die beim Lesen ablaufen. Auf der niederen Hierarchieebene sind alle Teilprozesse und entsprechende Teilkompetenzen des Lesens verortet, die sich auf das Verstehen von Wörtern und Sätzen beziehen: Rekodieren, Dekodieren, Propositionsbildung (Erkennen von Bedeutungseinheiten und von Beziehungen zwischen Wörtern im Satz), Erkennen von Kohäsionsmitteln (Nutzung bzw. Erkennen von sprachlichen Bindegliedern, Verbindungen zwischen Satzteilen und
Abb. 3: Teilprozesse im Leseverständnis (Lenhard, W. (2013). Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen – Diagnostik – Förderung. Stuttgart: Kohlhammer, S. 15)
Sätzen). Auf der hohen Hierarchieebene finden Teilprozesse statt, wie u. a. die Aktivierung von Vor- und Textformatwissen (Hinzuziehen von Vorwissen z. B. bei Sachtexten oder von Kenntnissen über bspw. die Gattung Fabel), Selbstregulation (Auswahl und Anwendung von Lesestrategien und Monitoring des Verständnisprozesses), globale Kohärenzbildung (Verdichtung der erfassten Bedeutungseinheiten (Propositionen) zu einem übergreifenden (globalen) Zusammenhang) sowie das Ziehen von Inferenzen (Ziehen von Schlussfolgerungen, die über direkte Aussagen im Text hinaus gehen, »Lesen zwischen den Zeilen«).
Während es bei den hierarchieniederen Lernprozessen zunächst um eine fehlerfreie und schnelle Worterkennung und ein Verstehen von Sätzen und kurzen Textabschnitten (lokale Kohärenzbildung) geht, führen hierarchiehohe Prozesse zu einem Situationsmodell bzw. mentalen Modell des gelesenen Textes, also zu einer übergeordneten (globalen) Kohärenzbildung über einzelne Bedeutungseinheiten hinweg.
Der Ablauf der genannten Teilprozesse des Leseverständnisses wird durch allgemeine individuelle kognitive Voraussetzungen beeinflusst. Zu diesen gehören das bereichsspezifische Vorwissen, die Arbeitsgedächtniskapazität, die Geschwindigkeit des Worterkennens (des Zugriffs auf das semantische Lexikon), die phonologische Bewusstheit und das schlussfolgernde Denken. Laut Lenhard (2013, 15) besteht zwischen den erläuterten Teilprozessen des Leseverständnisses keine strenge Abfolge, sie verlaufen vermutlich parallel und stehen in einer Wechselwirkung mit dem Ziel des Lesens (der Leseanforderung) und der Komplexität des Textmaterials.
Für die Entwicklung des Leseverständnisses bzw. der Lesekompetenz bedeutet dies, dass die Vermittlung und Steigerung hierarchieniederer Teilkompetenzen eng mit der Steigerung hierarchiehoher Teilkompetenzen (z. B. Aktivierung von relevantem Wissen, Selbstregulation) verbunden sind. Zwar können hierarchiehohe Teilprozesse des Leseverständnisses auch anhand von vorgelesenen oder durch Medien dargebotenen Texten entwickelt werden, dennoch ist die Entwicklung des Leseverständnisses eng mit der Entwicklung der Lesefertigkeit verbunden. Vermutlich sind die in der Praxis entstandenen unterschiedlichen curricularen Schwerpunktsetzungen in Klassenstufen bei der Vermittlung von Lesekompetenz für die meisten Schülerinnen und Schülern vorteilhaft: 1. Lesefertigkeit (Klasse 1 und 2), 2. Leseverständnis (ab Klasse 3) und 3. Literalität (in höheren Klassen). Wobei sich diese groben Schwerpunktsetzungen im Vermittlungs- und Erwerbsprozess von Lesekompetenz für das einzelne Kind unterschiedlich gestalten können und sie eher als sich überlappende Phasen zu konzeptualisieren sind. Die Hinführung zur Literatur als Kunstform und Teil von Kultur kann als parallel und überlappend zur schulischen Entwicklung der Lesekompetenz angesiedelte Intention schulischer Bildung angesehen werden, die mit dem Prozess der Entwicklung von Lesefertigkeit und Leseverständnis interagiert.
Abb. 4: Lesefertigkeit und Leseverständnis als Teil von Lesekompetenz (konzeptualisiert im Sinne von Teilhabe an der Kultur des geschriebenen Wortes)
Die Kunst eines auf Lesekompetenz ausgerichteten Deutschunterrichts besteht in einer systematischen Kompetenzentwicklung. Diese beginnt mit dem Schwerpunkt Lesefertigkeit unter Berücksichtigung von Aspekten des Leseverständnisses und setzt sich fort mit dem Schwerpunkt Leseverständnis bei gleichzeitiger Steigerung der Leseflüssigkeit sowie der Freude und des Interesses am Lesen. Weitergeführt wird sie mit Techniken der systematischen Texterschließung einschließlich von Lesestrategien. Leicht zeitversetzt bzw. -verzögert zu den Schwerpunkten des Lesekompetenzerwerbs sind Prozesse des Schreibenlernens, des Rechtschreiberwerbs und des schriftlichen Ausdrucks in den Deutschunterricht zu integrieren. Übungen des Rechtschreibens und der Textproduktion unterstützen den Erwerb der Lesekompetenz.
1.5 Zur Entwicklung der Rechtschreibkompetenz
»Die ganze Republik leidet an Rechtschreibschwäche…«, berichteten die Stuttgarter Nachrichten am 13.10.2017 und beziehen sich dabei auf die Ergebnisse einer großen Bildungsstudie des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB; Stanath, Schipolowski, Rjosk, Weirich & Haag, 2017). In einer für Deutschland repräsentativen Stichprobe von knapp 30.000 Schülerinnen und Schülern erreichten 22,1 % nicht die Mindeststandards, die an das rechtschriftliche Können von Viertklässlern angelegt werden. Die Analyse der rechtschriftlichen Kompetenzen zeigt, dass bei fast einem Viertel aller Kinder in der 4. Klasse die Laut-Buchstabenzuordnung nur ansatzweise gelingt, die Groß- und Kleinschreibung lediglich bei Substantiven mit gegenständlicher Bedeutung umgesetzt werden kann und Fehlerkorrekturen kaum möglich sind (Stanath et al., 2017). Die Frage, die sich Bildungsministerien, Schulen und Universitäten vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse stellen müssen, ist, wie der Rechtschreibunterricht verbessert werden kann, damit deutlich mehr Kinder davon profitieren. Dass dies keine einfache Aufgabe für die Lehrkräfte ist, zeigen Studien, die sich den Lernvoraussetzungen der Schulanfänger widmen. Die Leistungsdifferenzen können bis zu drei Entwicklungsjahre betragen (Brügelmann, 1984, S. 38), d. h., dass im Anfangsunterricht ein (Lese- und) Schreiblehrgang gewählt werden muss, in dem die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder berücksichtigt werden. Notwendig sind zudem umfassende Kenntnisse darüber, aus welchen Hauptkomponenten Rechtschreibung besteht und wie Kinder Rechtschreibung erwerben. Wie äußern sich besondere Schwierigkeiten im Rechtschreiberwerb und wie lässt sich durch einen präventiv ausgerichteten Unterricht Rechtschreibschwäche verhindern oder zumindest mindern? Bevor die letztgenannten Fragen im vierten Kapitel geklärt bzw. diskutiert werden können, stellt sich die Frage nach dem Rechtschreiberwerb von Kindern.
Nach Lindauer und Schmellentin (2017) sind die drei Hauptkomponenten der Rechtschreibkompetenz die orthografische Verschriftung, die Korrekturkompetenz und das explizite Regelwissen. Die orthografischen Verschriftungskompetenzen umfassen das implizite Rechtschreibwissen und beispielhafte Vorlagen für häufig verwendete Wort- und Satzstrukturen. Die Korrekturkompetenz erfordert eine bestimmte Sensitivität gegenüber fehlerhaften Schreibungen und Strategien zur Korrektur. Die Vermittlung des expliziten Regelwissens stellt einen großen Bereich des Rechtschreibunterrichts während der Primar- und Sekundarstufe I dar. Ziel ist es, dass Kinder eigene und vorgegebene Texte flüssig und korrekt schreiben können. Dazu müssen die notwendigen Grundlagen, u. a. Rechtschreibregeln, didaktisch aufbereitet und vermittelt werden. »Regelwissen umfasst neben dem Verstehen der (fürs Lernalter relevanten) Rechtschreibregeln ein Verständnis für die sprachsystematischen Konzepte, die der Regel zugrunde liegen …« (Lindauer & Schmellentin, 2017, 27).
Читать дальше