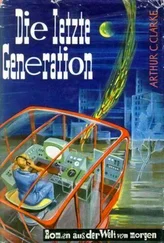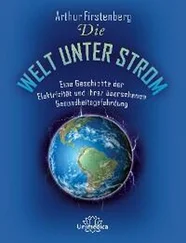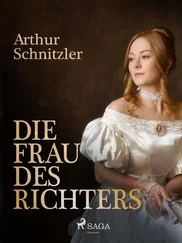Der erste große amerikanische Historiker bekräftigte alsbald Crèvecoeurs Standpunkt. „Löschen Sie“, schrieb George Bancroft 6,
„die Vergangenheit jeder einzelnen führenden Nation der Welt aus, und unser Schicksal wäre ein ganz anderes geworden. Italien und Spanien, in der Person von Kolumbus und Isabella, schlossen sich für jene große Entdeckung zusammen, die Amerika für Einwanderung und Handel aufschloss; Frankreich trug zu unserer Unabhängigkeit bei; die Suche nach dem Ursprung der Sprache, die wir sprechen, führt uns zurück bis nach Indien; unsere Religion stammt aus Palästina; von den Hymnen, die in unseren Kirchen gesungen werden, wurden einige zuerst in Italien vernommen, andere in den Wüsten Arabiens, wieder andere am Ufer des Euphrats; unsere Künste kommen aus Griechenland; unsere Rechtsprechung aus Rom; unser maritimer Kodex aus Russland; England lehrte uns das System der repräsentativen Regierung; die edle Republik der Vereinigten Provinzen – die Niederlande – hinterließ uns in der Welt des Denkens die große Idee der Toleranz aller Meinungen; in der Welt des aktiven Handelns das fruchtbare Prinzip der föderalen Union. Unser Land steht daher mehr als jedes andere für die Verwirklichung der Einheit des menschlichen Geschlechts.“
E pluribus unum – Eins werden aus Vielen. Die Vereinigten Staaten besaßen eine brillante Lösung für die inhärente Fragilität, ja Explosivität der multiethnischen Gesellschaft: die Schaffung einer gänzlich neuen nationalen Identität durch Individuen, die ihre alten Loyalitäten hinter sich ließen, hier ein neues Leben begannen und ihre ethnischen Differenzen einfach hinwegschmelzen ließen – eine nationale Identität, die die verschiedenen Ethnien, die unsere Küsten erreichen, absorbiert und sie transzendiert, Ethnien, die schon beim Eintreten in die neue nationale Identität die gemeinsame Kultur bereichern und umformen.
Jene unerschrockenen Europäer, die ihre Wurzeln gekappt hatten und die sich dem tosenden Atlantik entgegenwarfen, wollten eine schreckliche Vergangenheit hinter sich lassen und eine hoffnungsvolle Zukunft ergreifen. Sie sehnten sich danach, Amerikaner zu werden. Ihre Ziele waren Flucht, Erlösung, Assimilierung. Sie sahen Amerika als eine sich transformierende Nation, aus der sie schreckliche Erinnerungen verbannen und einen einzigartigen nationalen Charakter formen konnten, der auf gemeinsamen politischen Idealen und gemeinsamen Erfahrungen basierte. Die Entscheidung für Amerika bestand nicht darin, alte Kulturen zu bewahren, sondern eine neue, amerikanische Kultur zu schaffen.
Ein Grund, warum Kanada, trotz aller seiner Vorteile, so anfällig für Schismen ist, besteht in der Tatsache, dass, wie Kanadier freimütig zugeben, ihr Land eine solch einzigartige nationale Identität nicht besitzt. Immer wieder angezogen durch Großbritannien, Frankreich und die USA und aus Großzügigkeitserwägungen heraus einer Politik des offiziellen Multikulturalismus zugeneigt, haben Kanadier niemals ein starkes Bewusstsein dafür entwickelt, was es heißt, Kanadier zu sein. Mit den Worten von Sir John Macdonald 7, Kanadas erstem Premierminister: „Das Land hat zu viel Geographie und zu wenig Geschichte.“
Die USA dagegen haben eine reiche Geschichte. Seit den Tagen der Revolution besitzen die Amerikaner ein starkes nationales Identitätsgefühl, das im Unabhängigkeitskrieg geschmiedet, in der Erklärung von 1776 und der Verfassung von 1787 artikuliert und durch die spätere Erfahrung der Selbstverwaltung vertieft wurde. Die Kraft des nationalen Credos ist der Grund dafür, dass es uns relativ gut gelungen ist, die „promiskuitive Rasse“ Crèvecoeurs in ein Volk umzuwandeln und dadurch eine multiethnische Gesellschaft zum Funktionieren zu bringen.
Das soll nun aber nicht heißen, dass die Vereinigten Staaten Crèvecoeurs Maßstab immer gerecht geworden wären. Neue Einwanderungswellen brachten Menschen ins Land, die nur sehr schwer in die Gesellschaft hineinpassten – eine Gesellschaft, die in ihrer Sprache, ihren Idealen und ihren Institutionen ja unvermeidlich englisch war. Für lange Zeit dominierten die Angloamerikaner die amerikanische Kultur und Politik. Sie schlossen jene aus, die nach ihnen kamen. Anglo-Amerika assimilierte nur schwer die Einwanderer aus Irland, aus Deutschland oder aus Süd- und Osteuropa.
Hinsichtlich der nichtweißen Menschen – jenen also, die Amerika schon lange zuvor besiedelt hatten und die von den europäischen Neuzuwanderern überrannt und massakriert wurden, oder jenen anderen, die gegen ihren Willen aus Afrika und Asien ins Land hinein geholt wurden – verwies ein tief verwurzelter Rassismus alle, ob rote, schwarze, gelbe oder braune Amerikaner, hinter die Grenzen ihres jeweiligen Grundstücks. Wir müssen uns einer beschämenden Tatsache stellen: Historisch gesehen war Amerika eine rassistische Nation. Weiße Amerikaner begannen als ein Volk, das in der Überzeugung von seiner rassischen Überlegenheit so arrogant war, sich ermächtigt zu fühlen, rote Menschen zu töten, schwarze Menschen zu versklaven und gelbe und braune Menschen für Tagelöhnerarbeiten zu importieren. Wir weißen Amerikaner waren rassistisch in unseren Gesetzen, in unseren Institutionen, in unseren Sitten, in unseren eingeübten Reflexen und in unseren Seelen. Der Fluch des Rassismus war das große Versagen des amerikanischen Experiments, der schreiende Widerspruch des amerikanischen Idealbilds und die noch immer lähmende Krankheit des amerikanischen Lebens – „die schönste Hoffnung der Welt“, schrieb Herman Melville, „verkettet mit des Menschen schlimmsten Verbrechen.“
Doch auch nichtweiße Amerikaner, obwohl miserabel behandelt, trugen zur Ausgestaltung der nationalen Identität bei. Auch sie, als Menschen dritter Klasse, hatten Anteil an der gemeinsamen Kultur der amerikanischen Gesellschaft und verhalfen ihr zu neuer Form und Gestalt. Das Hineinströmen nicht–angelsächsischer Stämme und die Erfahrung einer Neuen Welt formten das britische Erbe um; es machte die USA, wie wir alle wissen, zu einem ganz anderen Land, als Großbritannien es heute ist. Schon 1831 war Alexis de Tocqueville 8, der große Kommentator der amerikanischen Demokratie, beeindruckt von dem „immensen Unterschied zwischen den Engländern und ihren Nachkommen in Amerika.“
Im Verlauf der zwei Jahrhunderte amerikanischer Geschichte bestand über die meiste Zeit hinweg die Vision von Amerika als eines zu einem einzigen Volk verschmolzenen Landes. Das 20. Jahrhundert brachte freilich eine neue, gegenteilige Vision hervor. Der Erste Weltkrieg zerstörte die alte Ordnung der Dinge und machte Platz für Woodrow Wilsons 9Doktrin von der Selbstbestimmung der Völker. 20 Jahre später löste der Zweite Weltkrieg die westlichen Kolonialreiche auf und intensivierte ethnische Militanz rund um den Planeten. In den Vereinigten Staaten selbst erleichterten neue Gesetze den Zutritt für Einwanderer aus Südamerika, Asien und Afrika – sie änderten die Zusammensetzung des amerikanischen Volkes.
In einem Land, das durch eine viel ungewöhnlichere Blutsmischung gekennzeichnet ist, als Crèvecoeur es sich je hätte vorstellen können, wird dessen gefeierte Frage aufs Neue aufgeworfen – mit neuer Leidenschaft und einer neuen Antwort. Heutzutage haben viele Amerikaner dem historischen Ideal einer „neuen menschlichen Rasse“ (im Sinne Crèvecoeurs, A. d. Ü.) abgeschworen. Die Flucht aus der Herkunft führt zur Suche nach den eigenen Wurzeln. Die „hergebrachten Vorurteile und Verhaltensweisen“, von Crèvecoeur noch verleugnet, haben ein überraschendes Comeback erfahren. Ein Kult der Ethnizität hat sich entwickelt – sowohl unter nicht-angloamerikanischen Weißen als auch unter nichtweißen Minderheiten. Dieser Kult verunglimpft das Ziel der Assimilierung und fordert das Konzept des „einen Volkes“ heraus, er schützt und fördert getrennte ethnische und Herkunfts- Gemeinschaften und will sie nun auf Dauer fortbestehen lassen.
Читать дальше