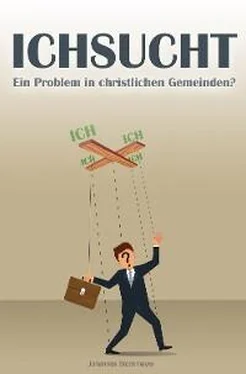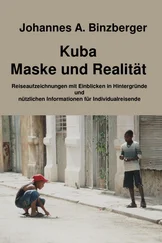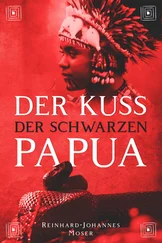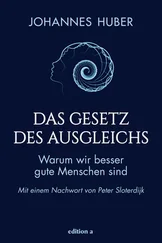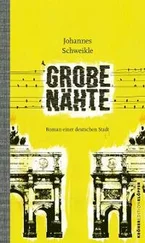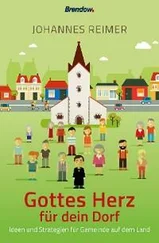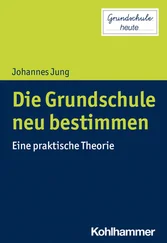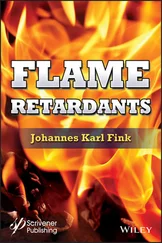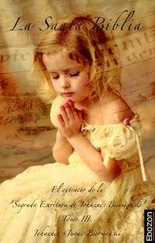Für Gottes Reich und seine Gemeinde gilt: Einheit und Pluralität sind keine Gegensätze. Die Einheit besteht aus starken Ichs, nicht aus gefügigen, gleichgemachten. Nachfolge ist keine Passivität, sondern ein aktives, eigenverantwortliches Vorangehen. Gemeinschaft bedeutet Arbeit, sich ausliefern, einander begegnen. Einheit entsteht dadurch, dass man die Gegensätze aushält, erträgt und sich ein- und unterordnet. Einmütigkeit geht nur über langwierige Prozesse des Redens und Hörens – vor allem in dem Bemühen, einander verstehen zu wollen. Die Gemeinschaft der Christen marschiert nicht im Gleichschritt der Gleichgesinnten, sondern lebt von der Verschiedenartigkeit der Geistesgaben, die im Leib Christi aufeinander angewiesen sind. Nicht alle sind gleich, sondern jeder hat seinen Auftrag, jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass das Ganze gelingt. Die christliche Gemeinschaft ist keine abgeschlossene Ganzheit, sondern ein spannungsreiches Gefüge aus vielen selbstständigen Ichs, die sich einbringen, sich aufgeben und dabei sterben. Das Miteinander der Christen ist keine zu sichernde Stabilität, sondern ein labiles Fließgleichgewicht, keine statische Figur, sondern ein dynamischer Prozess, an dem jeder beteiligt ist. Jeder. Auf seine Weise. Und zwar so, dass miteinander Ziele erreicht werden, für die sich jeder auf seine ureigene Weise einsetzt. Viele unterschiedliche Schritte sind nötig, um am gemeinsamen Ziel anzukommen.
Die Gemeinde als Leib (1. Korinther 12,12 ff.) ist nicht das Produkt ihrer Glieder, sondern die Schöpfung Gottes. Niemand kann die Gemeinde für sich vereinnahmen oder seinen Wert daraus ziehen, dass er dazugehört. Denn jeder gehört Gott und alle sind von Gott beschenkt mit ihrem unverwechselbaren Ich. Das dürfen sie einbringen – zur Ehre Gottes und zum Aufbau dieses Leibes. Jeder gibt und Gott nimmt. Und von dem, was Gott dann allen austeilt – nicht gleichmäßig, nicht gerecht, aber doch so, dass jeder das bekommt, was er benötigt –,nährt sich die Existenz eines jeden. Jeder wird satt, niemand kommt zu kurz. Keiner leidet Mangel. Das echte Wir gibt dem Einzelnen Raum und die Möglichkeit, seine Meinung zu äußern, sich zu entfalten und anders zu sein als die anderen. Das echte Wir ist das Wir, das Gott ermöglicht. Es setzt sich zusammen aus erlösten und befreiten Ichs.
Gibt es Ichlinge in der christlichen Gemeinde? Vor allem gibt es sie dort, wo Menschen ihren Mangel in der Gemeinde stillen wollen. Weil sie ihre tiefe Bedürftigkeit mitbringen und fordern, dass andere sie satt machen. Ichlinge gibt es dort, wo das Ich an der Garderobe abgegeben wird und die Gemeindeglieder zum Es werden, die sich wie Babys versorgen lassen. Es passiert dann Folgendes: Die Predigt wird zur Verkündigung und ist keine lebendige Begegnung mit Gott mehr. Das Gebet wird zur Liturgie und das Gespräch zwischen Mensch und Gott erlahmt. Der Glaube reduziert sich auf das Für-wahr-Halten und äußert sich nicht in einer tiefen Beziehung zum Gott des Lebens. Die Kirche wird zur Wohlfühlgemeinde und die Gemeinschaft zur Heilsinstanz eines frommen Wirs, das die Seele streichelt.
In der Gemeinschaft der Ichlinge hat auch die Ichsucht ihren Platz. Es ist das große Ich, das sich über die anderen kleinen, rudimentären Ichs stellt und sie beherrscht – weil es dadurch seinen Wert und seine Bedeutung bekommt. Aber alle anderen bleiben klein und abhängig.
Die tiefe Sehnsucht der Menschen nach dem wahren, dem wirklichen, dem echten Leben fordert den Menschen auf, sich auf die Suche zu machen. Es ist die Suche nach dem „Ich”. Wird er nicht fündig, misslingt die Suche oder geht in die Irre, wird sie zur Sucht: Der Mensch wird abhängig – von seinen Bedürfnissen und von anderen Menschen. Denn im Bereich seiner Sehnsüchte ist der Mensch am verletzlichsten. Wenn es um sein Ich geht, geht es um alles, geht es um seine ganze Existenz.
2Ulrich Beck, Risikogesellschaft, Frankfurt 1986, Seite 199
3Faith Popcorn, Der Popcorn Report, München 1992, Seite 40
4Claudia Szczesny-Friedmann, Die kühle Gesellschaft, München 1991, Seite 11
5Heiko Ernst, Psychotrends, München 1996, Seite 14
6Friedrich Schorlemmer, Zeitansagen, München 1999, Seite 342
7K. Peter Fritzsche, Die Stressgesellschaft, München 1998, Seite 10 ff.
8Johannes Fiebig, Abschied vom Ego-Kult, Krummwisch 2001, Seite 122
9Horst W. Opaschowski, Deutschland 2020, Wiesbaden 2004, Seite 39
10Horst W. Opaschowski, Wir! Warum Ichlinge keine Zukunft haben, Hamburg 2010
11Matthias Horx, Das Megatrend Prinzip, München 2011, Seite 126
12 www.alltagsforschung.de/die-psychologie-des-narzissmus/
13Gerhard Schulze, Die beste aller Welten, München 2003, Seite 212
14Peter Hahne, Schluss mit lustig, Lahr 2004, Seite 141
15Stephan Grünewald, Deutschland auf der Couch, Frankfurt 2006, Seite 63
16Hans-Willi Weis, Exodus ins Ego, Düsseldorf 1998, Seite 10 ff.
17Frank Schirrmacher, Ego – Das Spiel des Lebens, München 2013
18Thomas Ramge, Nach der Ego-Gesellschaft, München 2006, Seite 202
19Horst-Eberhard Richter, Das Ende der Egomanie, Köln 2002
20Horst W., Opaschowski, Wir!, Hamburg 2010, Seite 200 f.
21Stephan Valentin, Ichlinge, München 2012, Seite 328
22Horst-Eberhard Richter, Der Gotteskomplex, Gießen 2005, Seite 35
23Horst-Eberhard Richter, Die Krise der Männlichkeit, Gießen 2006, Seite 80
24Viktor E. Frankl, Ärztliche Seelsorge, München 2014
25Martin Buber, Ich und Du, Stuttgart 1995, Seite 12
26Karl Jaspers, Philosophie Band 2, Berlin 1932, Seite 51, zitiert nach Otto Friedrich Bollnow, Existenzphilosophie, Stuttgart 1949, Seite 46
27Nach Otto Friedrich Bollnow, Existenzphilosophie, Stuttgart 1949, Seite 46
28Elias Canetti, Masse und Macht, Frankfurt 1980, Seite 30
29Erich Fromm, Anatomie der menschlichen Destruktivität, Hamburg 1977, Seite 229
2.Die Sehnsucht der Menschen
Auf der Suche nach dem Ich
In unserer konsumorientierten Gesellschaft werden alle Sehnsüchte der Menschen bedient. Für Geld kann man alles haben. Wirklich alles? Es gibt Sehnsüchte, die bleiben unbefriedigt, auch wenn man Geld genug hat. Sie zu stillen wird zu einem größeren Wert als alle Konsumartikel. Diese Sehnsüchte haben alle mit dem Ich des Menschen zu tun: mit seinem Selbstverständnis, seinem Selbstwert, seiner Identität. Der Kampf um das „Ich” ist entbrannt. Es geht darum, das Ich zu fördern, zu optimieren, zu finden und zu entfalten, möglichst groß zu machen, aufzupolieren, durchsetzungsfähig zu gestalten, unverletzlich abzusichern und vieles mehr. Aber das geht nur, wenn das Ich in seiner Wurzel gesund ist. Stimmt die Grundlage nicht, ist sämtliche Arbeit am Ich doch nur eine kosmetische Operation, eine mühsame Reparatur und es bleibt beim Versuch, etwas abzustützen, was wackelig ist. In folgenden Sehnsüchten zeigt sich, wo das Ich Mangel leidet:
1. Die Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung
Liebe und Anerkennung sind etwas Selbstverständliches, sie sind überlebensnotwendig. Wer keine Liebe und Anerkennung bekommt, verkümmert. Deshalb will jeder Mensch wahrgenommen und geliebt werden. Er will wichtig sein. Aber wer gibt Liebe und Anerkennung, wenn sie jeder für sich möchte? In unserer Gesellschaft gibt es zunehmend viele Ichs, die gesehen werden wollen. Wer schaut sie an? Viele schreien nach Zuwendung. Wer hört sie und gibt ihnen, was sie brauchen?
2. Die Sehnsucht nach Sicherheit
Die Komplexität der Welt ist für viele verunsichernd. Die ständigen Veränderungen und Umbrüche lassen nicht zur Ruhe kommen. Was heute gilt, ist morgen anders. Die Zukunft ist fragwürdig. Das Gleichgewicht der Mächte ist filigran und bedroht. Die wirtschaftliche Stabilität ist nicht nachhaltig. Permanent bedroht eine Krise die momentane Ruhe. Es gibt keine wirkliche Absicherung, nichts ist tatsächlich dauerhaft stabil. Was ist zu tun? Wo gibt es Orte der Geborgenheit? Wo kann man sich wirklich sicher sein?
Читать дальше