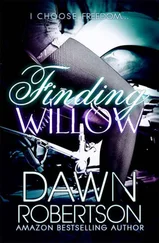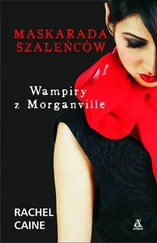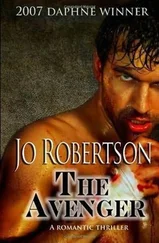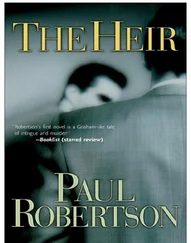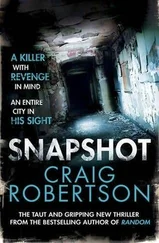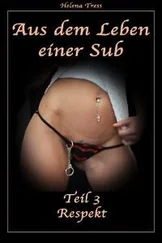Körperliche Gesundheit und Sicherheit
Die Antarktis ist einer der von Natur aus gefährlichsten Arbeitsorte der Welt. Zur rauen Umwelt kommt noch erschwerend hinzu:
begrenzte medizinische Versorgung: Ein Arzt, ein kleiner OP‐Saal, und die Rolle des OP‐Assistenten wird vom IT‐Spezialisten übernommen;
extrem schwierige Evakuierung im Notfall: Während der langen Wintermonate von März bis November kann es Monate dauern, bis Hilfe eintrifft;
die unausweichliche Tatsache, dass Teammitglieder übernehmen müssen, wenn eine Person durch Krankheit oder Verletzung ausfällt: Die Arbeit muss auch weiterhin erledigt werden, inklusive Haushaltstätigkeiten und Putzen.
Mentale Gesundheit und Sicherheit
Wir würden ein ganzes Jahr lang auf engstem Raum zusammenleben müssen, zusammengedrängt in ein paar kleinen Gebäuden. Wie würden wir mit diesem einschränkenden Umfeld klarkommen? Dazu gehört:
Die fehlende Privatsphäre: Jeder weiß alles; wenn Sie einmal einen schlechten Tag haben, erfährt es gleich das ganze Team.
Heimweh: Auch noch so viel Telefonieren kann das nicht beseitigen.
Das Fehlen der normalen Unterstützungsstrukturen: Keine Familie, keine Treffen mit Freunden, kein Kirchgang, keine Sportveranstaltungen; nicht einmal den Hund kann man ausführen.
Umfassende Veränderungen in vielerlei Hinsicht: Ernährung, Technik, Arbeitsgestaltung, Pausen, Umwelt.
Bedeutend geringere persönliche Wahl‐ und Entscheidungsmöglichkeiten: Lust auf Pasta heute Abend? Pech gehabt, der Koch hat gebratenes Hühnchen gemacht.
Fehlende körperliche Nähe: Für die meisten von uns wird es ein Jahr werden, in dem es nicht einmal eine Umarmung geben wird.
Für viele Menschen ist der Eintritt in den australischen Staatsdienst mit all den Grundsätzen und Verfahrensvorschriften, die zu befolgen sind, wenn man vom Steuerzahler finanziert wird, gewöhnungsbedürftig. Dazu kommt:
Viele Expeditionsteilnehmer, insbesondere aus dem kaufmännischen Bereich, hatten bisher selbstständig gearbeitet und waren niemandem außer ihren Kunden verantwortlich gewesen.
Da wir in einer anderen Zeitzone lebten, waren wir mit unseren Arbeitszeiten der Zentrale mehrere Stunden hinterher; das bedeutete, dass Antworten auf unsere Fragen mitunter erst am nächsten Tag eintrafen.
Die Zentrale konnte im wirklichen Sinne des Wortes nicht wissen, was vor Ort geschah.
Für die Leute galten vielfältige Rechenschaftspflichten; das bedeutete für mich als Stationsleiterin, dass die Leute meines Teams den Leitern von Wissenschaftsprogrammen in Universitäten, Ingenieurteams, Kommunikationsteams und so weiter verantwortlich waren. Es war eine komplizierte Matrix von Verantwortlichkeiten und Berichtsverhältnissen.
Als Leiterin wusste ich, dass auf mich noch eine Reihe weiterer Herausforderungen zukommen würde. Ich würde immer im Dienst sein. Auch an Sonntagen (normalerweise ein freier Tag im Winter) müsste ich arbeiten und die Chefin sein. Und wie es in Führungspositionen immer der Fall ist, stand ich unter strenger Beobachtung und wusste, dass jede meiner Entscheidungen, wie banal sie auch war, auseinandergepflückt und kritisiert werden würde.
Dann war da auch noch die spezielle Aufgabe der Leistungsbeurteilung. Wie sollte ich ohne Sanktionsmöglichkeiten mit schlechten Leistungen umgehen, und wie sollte ich herausragende Leistungen ohne handfeste Belohnungsmöglichkeiten würdigen?
All dies zusammengenommen, war es eine Ehrfurcht gebietende Herausforderung. Und neben all dem mussten wir ja auch noch die wissenschaftlichen Projekte erfolgreich absolvieren, die Station sommers wie winters in Betrieb halten, die Infrastruktur pflegen und warten und uns auf den nächsten Trupp Expeditionsteilnehmer vorbereiten.
Und das Ganze mit einem Haufen zufällig zusammengewürfelter Fremder.
Die Menschen werden von ganz unterschiedlichen Dingen gestresst. Was für die eine Person eine Kleinigkeit ist, kann die andere völlig aus der Bahn werfen. Das Wissen, dass Stressoren individuell sind, hilft Empathie zu entwickeln.
Die Wirkung von Veränderungen ist in der Regel kumulativ. So wird eine einzige Veränderung, wie etwa ein neuer Arbeitsbeginn, eine Person vielleicht noch nicht besonders stören, aber nehmen Sie dann noch eine Umstrukturierung, Überlegungen zu einer Büroverlagerung und Gespräche über eine Zusammenlegung hinzu, und die kumulative Wirkung kann gewaltig sein.
Diversität wird zur Party eingeladen – Inklusion wird zum Tanzen aufgefordert
Wie schon erwähnt, war das Einzige, was die Mitglieder unseres Expeditionsteams gemeinsam hatten, der relativ radikale Entschluss, in der Antarktis zu leben. Das hatte ich so nicht erwartet. Ich hatte angenommen – zu Unrecht –, dass wir alle einen ähnlichen Background aufweisen würden, in etwa im gleichen Alter wären, alle einen ähnlichen Sinn für Abenteuer haben würden. Das war nicht der Fall, aber es dauerte eine Weile, bis ich das begriff.
Als ich meine Team‐Fotos durchsah, war ich zunächst verblüfft, wie ähnlich wir uns alle schienen. Alle weiß, überwiegend Männer. Verbindende Merkmale wie gemeinsame Werte, Erfahrungen und Erlebnisse zu finden müsste also leicht sein, dachte ich. Aber je mehr ich meine Leute kennenlernte, desto mehr stellte sich heraus, wie unterschiedlich wir alle waren.
Ich bin sehr für Diversität und für Proaktivität in dieser Richtung. Im Bereich Wirtschaft sind die Argumente pro Diversität unbestreitbar. Es gibt Unmengen von Forschungsmaterial, das belegt, dass unterschiedlich zusammengesetzte Teams, wenn ihre Diversität gut genutzt wird, bessere Entscheidungen treffen und innovativer sind. Und es gibt auch Dutzende von Fallstudien, die zeigen, wie Teams ineffektiv wurden, weil sie nicht in der Lage waren, ein Umfeld zu schaffen, in dem sie die Unterschiede ihrer Teammitglieder bestmöglich nutzen konnten.
Diversität reicht natürlich viel tiefer als die sichtbaren Unterschiede. Sie geht weit über Rasse, Alter und Geschlecht hinaus. Wenn nur das allein zählte, würden Sie beim Blick auf mein Team denken, wir wären zu 90 Prozent homogen gewesen.
Was weit entfernt von der Wahrheit war, obwohl ich das erst nach langer Zeit erkannte, als ich jeden Einzelnen kennen und verstehen gelernt hatte. In meinem kleinen Team der Expeditionsteilnehmer, die über den Winter mit mir auf der Station bleiben sollten, manifestierte sich diese Diversität – abgesehen von Rasse, Geschlecht und Alter – …
im Ausbildungsniveau (von Handelsschule bis hin zu mehreren Doktortiteln),
in der Denkart (von logisch und rational bis hin zu emotional und intuitiv),
im Umgang mit Konflikten (von Hitzköpfen bis hin zu jenen Menschen, die Uneinigkeit und Ärger verinnerlichen),
im beruflichen Background und in der Berufserfahrung,
in der Generation (von Millennials bis hin zu Babyboomern),
im Beziehungsstatus (Single, verheiratet, mit oder ohne Familie, geschieden, verwitwet),
in der familiären Verantwortung (mit Kindern oder anderen von ihnen abhängigen Angehörigen wie betagten Eltern oder Verwandten mit besonderen Bedürfnissen),
in der sexuellen Orientierung,
in Introvertiertheit versus Extrovertiertheit,
im sozioökonomischen Background,
in der Lebenserfahrung (manche hatten zuvor nur im ländlichen oder regionalen Australien gelebt, während andere lange Zeit in Übersee gewesen und regelmäßig umgezogen waren),
im ethnischen Background (Australier der ersten bis fünften Generation),
in der Antarktis‐Erfahrung (von Ersttätern bis hin zu Veteranen, die schon mehrere Reisen unternommen hatten),
in der Einstellung zu Risiken und zum Unbekannten (Begrüßen oder Ablehnen von Veränderungen).
Читать дальше