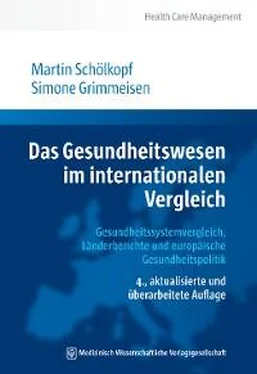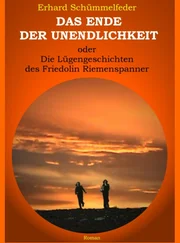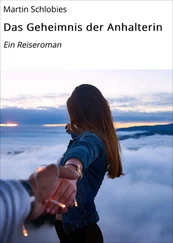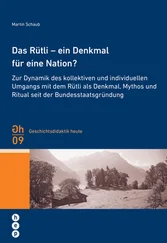4 Stationäre Versorgung
4.1 Ausgaben für die stationäre Versorgung
4.2 Versorgungskapazitäten, Leistungen und Verweildauer
4.2.1 Krankenhauskapazitäten und Versorgungsniveaus
4.2.2 Leistungen
4.2.3 Krankenhausverweildauer
4.2.4 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung
4.2.5 Personalausstattung
4.3 Organisation, Planung und Finanzierung im stationären Sektor
4.3.1 Krankenhausplanung
4.3.2 Investitionskostenfinanzierung
4.4 Die Vergütung der Krankenhäuser
5 Die ambulante ärztliche Versorgung
5.1 Ausgaben für die ambulante Versorgung
5.2 Versorgungskapazitäten und Inanspruchnahme
5.2.1 Inanspruchnahme der ambulanten ärztlichen Versorgung
5.2.2 Arbeitszeit und Arbeitsbelastung
5.3 Organisation der Leistungserbringung
5.3.1 Die Rolle der hausärztlichen Versorgung
5.3.2 Ambulante fachärztliche Versorgung
5.3.3 Sachleistungs- versus Kostenerstattungsprinzip
5.4 Vergütungsstrukturen und Einkommen der Ärzte
5.4.1 Strukturen der ärztlichen Vergütung
5.4.2 Einkommenssituation niedergelassener Ärzte
6 Arzneimittelversorgung
6.1 Ausgaben für die Arzneimittelversorgung
6.2 Ziele der Arzneimittelregulierung
6.3 Arzneimittelzulassung
6.4 Erstattungsfähigkeit
6.4.1 Positiv- und Negativlisten
6.4.2 Zentrale und dezentrale Entscheidungsfindung
6.4.3 Höhe des Erstattungsanspruchs und Erstattungszeitpunkt
6.4.4 Kriterien für Einschluss bzw. Ausschluss der Erstattungsfähigkeit
6.5 Preisbildung
6.5.1 Externe Preisreferenzierung
6.5.2 Interne Preisreferenzierung
6.5.3 Weitere Instrumente zur Preisfindung
6.5.4 Mehrwertsteuer
6.6 Arzneimittelzuzahlungen
6.7 Steuerung des ärztlichen Verschreibungsverhaltens
6.7.1 Arzneimittelbudgets und Richtgrößen
6.7.2 Qualität der Arzneimitteltherapie
7 Die Leistungsfähigkeit von Gesundheitssystemen: Effizienz, Qualität und Nutzerorientierung
7.1 Einleitung
7.2 Die Studie des Fritz Beske-Instituts für Gesundheitssystemforschung
7.3 Der Vergleich der Konsumentenfreundlichkeit der Gesundheitssysteme von Health Consumer Powerhouse
7.4 Die Vergleichsstudien des Commonwealth Fund zur Nutzerorientierung und zur Qualität von Gesundheitssystemen
7.5 Befragungen zur Zufriedenheit, zum Zugang und zur Qualität in der EU
7.5.1 Zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem
7.5.2 Zugang zur medizinischen Versorgung
7.5.3 Qualität der medizinischen Versorgung
7.6 Die Ergebnisse des Health Care Quality Indicators-Projekts der OECD
8 Die europäische Gesundheitspolitik
8.1 Die „echte“ Gesundheitspolitik der Europäischen Union
8.2 Die Freiheiten des Binnenmarkts und die Auswirkungen auf das Gesundheitswesen
8.2.1 Die Freizügigkeit und die Gesundheitsleistungen
8.2.2 Die Dienstleistungsfreiheit im Gesundheitswesen
8.2.3 Die Krankenkassen und das Wettbewerbs- und Vergaberecht
8.2.4 Wettbewerbsrecht, Beihilfenproblematik und deutsche Krankenhäuser
8.2.5 Arzneimittelrecht in der Europäischen Union
8.2.6 Europäisches Medizinprodukterecht
9 Weiterführende Informationen
9.1 Zahlen und Daten zum internationalen Vergleich
9.2 Fakten über die Gesundheitssysteme anderer Länder
9.3 Informationen zur europäischen Gesundheitspolitik
Literatur
Sachwortverzeichnis
Das Autoren-Team
Der Herausgeber der Schriftenreihe Health Care Management
1 Die Gesundheitssysteme im internationalen Vergleich: Typologie und Entstehungsprozess
1.1 Eine Typologie der Gesundheitssysteme
Wer im europäischen Ausland Urlaub macht oder in einem anderen Land arbeitet oder studiert und plötzlich medizinische Hilfe benötigt, wird schnell zwei Dinge feststellen: Zum einen verfügen sämtliche Länder West- und Mitteleuropas, aber natürlich auch andere Länder der westlichen Welt, über hoch entwickelte Gesundheitssysteme. Sieht man (wieder) von den USA – unter dem früheren Präsident Barack Obama war das anders – ab, herrscht zudem längst übereinstimmend die Auffassung, dass es Aufgabe des Staates ist, für die Bevölkerung eine angemessene Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Diese Auffassung hat ihren Niederschlag darin gefunden, dass der öffentlichen Hand im Gesundheitswesen in aller Regel eine dominierende Rolle zukommt. Der Staat plant, reguliert und finanziert; und häufig erbringt er auch selbst Leistungen.
Wer medizinische Leistungen im Ausland benötigt, wird zum anderen aber auch feststellen, dass bestimmte Charakteristika des jeweiligen Gesundheitssystems vom deutschen Gesundheitswesen abweichen – und dies zum Teil erheblich. So gibt es Länder, in denen die gesamte Krankenhausversorgung in den Händen der Kommunen liegt; die in Deutschland in der öffentlichen Versorgung ebenfalls wichtigen privatwirtschaftlichen und freigemeinnützigen Krankenhäuser wird man dort vergeblich suchen. In einigen Ländern findet – anders als in Deutschland – die ambulante fachärztliche Behandlung ausschließlich im Krankenhaus statt. In manchen Ländern wiederum ist das Sachleistungsprinzip – Patienten erhalten die medizinische Leistung kostenlos, die Leistungserbringer werden von der Krankenkasse bezahlt – unbekannt; die Patienten müssen dort die Leistungen erst einmal selbst finanzieren und bekommen die Kosten anschließend von ihrer Krankenkasse bzw. Krankenversicherung erstattet.
Während also in allen Industriestaaten im Wesentlichen ein gemeinsames Verständnis über die Notwendigkeit eines leistungsfähigen Gesundheitssystems besteht und auch die herausragende Bedeutung des Staates bei der Gewährleistung der Gesundheitsversorgung meist unbestritten ist, lassen sich in der Organisation der Gesundheitsversorgung im Detail erhebliche Unterschiede feststellen. Die Wissenschaft hat bereits früh versucht, diese Differenzen herauszuarbeiten und zu typologisieren. Die erste und zur Einordnung von Gesundheitssystemen immer noch häufig genutzte Typologie ist die Differenzierung in Länder, deren Gesundheitswesen sich am Bismarck- bzw. Beveridgemodell orientieren (vgl. Tab. 1).
Tab. 1Idealtypische Ordnung von Gesundheitssystemen: Bismarck versus Beveridge
| Strukturprinzipien |
Bismarck |
Beveridge |
| Grundprinzip |
(Sozial-)Versicherungsprinzip |
Versorgungsprinzip |
| Verwaltung |
Selbstverwaltung |
Staat |
| Finanzierung |
(Sozialversicherungs-)Beiträge |
Steuern |
| Leistungsanspruch |
Sachleistung/Kostenerstattung |
Sachleistung |
| Leistungserbringung |
öffentlich/privatwirtschaftlich freigemeinnützig/ |
öffentlich |
| abgesicherter Personenkreis |
ausgewählte Personengruppen |
gesamte Bevölkerung |
Das Bismarcksche Modell der sozialen Sicherung, in Deutschland von Reichskanzler Otto von Bismarck mit dem Ziel der Befriedung der Arbeiterschaft eingeführt, zielt auf Lebensstandardsicherung sowie Beitrags- und Leistungsgerechtigkeit. Zentrales Grundprinzip ist das Sozialversicherungsprinzip: Sozialrechtliche Ansprüche werden im Sinne einer Versicherung über Beiträge aus dem Lohneinkommen erworben. Die Höhe des Anspruchs bei Einkommensersatzleistungen hängt im Regelfall von den zuvor gezahlten Beiträgen ab. Dieses Prinzip ist insbesondere für die Altersrente und beim Arbeitslosengeld charakteristisch. In der Gesundheitsversorgung greift es nur beim Krankengeld; ansonsten dominiert dort das Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit: Versicherte erhalten die notwendigen medizinischen Leistungen entsprechend ihres Bedarfs, unabhängig von der Höhe der geleisteten Beiträge. Dem Staat kommt im Bismarck-Modell nur eine indirekte Funktion zu: Er gestaltet den rechtlichen Rahmen. Die konkrete Steuerung hingegen erfolgt im Rahmen der Selbstverwaltung durch die Krankenkassen und die Leistungserbringer, insbesondere Ärzte und Krankenhäuser, bzw. ihre jeweiligen Verbände.
Читать дальше