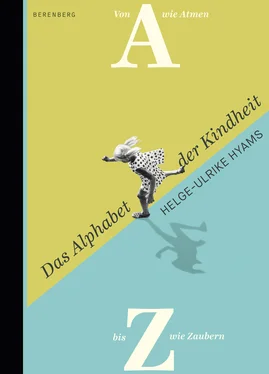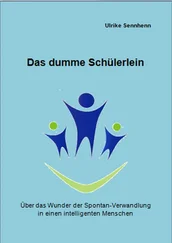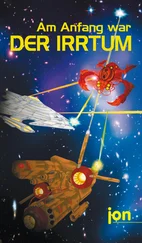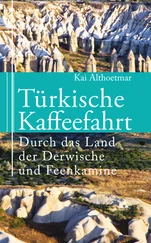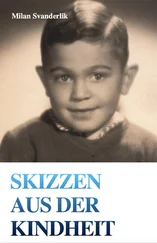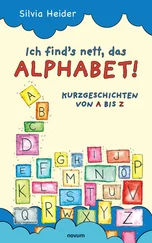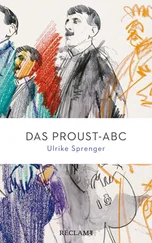»Meine Schulkameraden und ich, wir haben uns tolle Sachen erzählt: was wir alles machen wollen in den Ferien. Aber dann hat Chlodwig gesagt, er rettet wieder jemand, der ertrinkt, wie voriges Jahr – so’n Quatsch! Ich habe gesagt, er lügt, nämlich ich hab ihn doch im Schwimmbad gesehen und er kann ja gar nicht schwimmen.«
René Goscinny
Das Schönste an den Ferien ist, dass sie mit Sicherheit wiederkehren. Ferien sind ja per se nicht immer nur glückserfüllt, doch sie sind das pure Gegenteil von Schule und deshalb so begehrenswert. Kein frühes Rausreißen aus den Träumen, kein Gedrängel im Schulbus, keine Klassenarbeit, kein Nachsitzen – frei sein von all dem. Man gehe nur einmal an einem letzten Schultag vor den Sommerferien auf einen beliebigen Schulhof: Das Gekreische der Kinder gilt nicht (nur) den Ferien selbst, sondern der Befreiung von der Schule.
Was die Ferien anbelangt, so ist es ein bisschen wie Weihnachten. Entweder sie gestalten sich rundum kinderfreundlich, das heißt die wie auch immer zusammengewürfelte Familie verbringt diese Zeit auf intensive Weise und zur Zufriedenheit aller gemeinsam – und dies am liebsten auf Reisen. Oder aber die schon bestehenden Risse und Nöte einer Familie brechen, jenseits von Arbeits- und Schulroutine, in den Ferien offen und destruktiv auf und bedrängen alle – und eben auch das Kind. Nicht wenige Kinder in Trennungs- oder Scheidungsfamilien beispielsweise spüren gerade jetzt die Entfremdung der Eltern doppelt und müssen komplizierte Ferienarrangements über sich ergehen lassen. 87
Bisweilen ist Reisen auch Prestigeangelegenheit. Deshalb quälen sich Kinder aus sozial schwachen Familien häufig und fühlen sich beschämt, wenn die anderen von fantastischen Ländern erzählen, sie selbst derweil zu Hause oder bei der Oma blieben. Da bleibt als Ausweg, sich selber Reiseabenteuer auszudenken. Viele Jungen und Mädchen sind darin Meister. Sie erlügen sich originelle Feriengeschichten, um mit den schillernden Schilderungen der anderen mitzuhalten (kürzlich erfuhr ich von einem Jungen, der sogar eine »Bombe vor dem Hotel« erlog). Das allerdings spricht nicht gegen diese Kinder, sondern eher für ihre lebendige, kreative Fantasie.
Nicht selten erlebt man auch, wie Eltern sich zielgerichtet um Fremdunterbringung der eigenen Kinder bemühen (Organisation von Ferienlagern, Ausland-Austausch und anderes), um in den Ferien entlastet zu sein oder aber ihrer Arbeit nachgehen zu können. Familienferien mit Kindern sind oft aufreibend und deshalb nicht jedermanns Sache. 88Und so erlaubt denn auch die Weise, wie eine Familie ihre Ferien plant 89und schließlich real durchlebt, Rückschlüsse auf die Art des familiären Umgangs und Zusammenhalts generell. Schließlich sagt die Feriengestaltung viel über Bildungsbeflissenheit einer Familie aus. Manche Eltern wollen jeden freien Moment ihrer Kinder für deren kulturelle, musikalische und sportliche Weiterbildung nutzen und finden reichlich attraktive Angebote dazu.
Ich halte dieses Zwischenreich der Schulferien für eine große Chance, dass die Kinder sich wenigstens vorübergehend erholen dürfen von dem dauernden Müssen , von dem dauernden Gefordertsein, von dem Eingespanntsein in Zeitfenstern. Kinder brauchen rhythmisch wiederkehrende Pausen und Freiräume, um Impulse auszuleben, die während der Schulzeit niedergehalten werden müssen.
Plötzlich, ganz ohne Schule, beginnt das Kind nämlich überraschend zu experimentieren, es findet und erfindet Ungewohntes und Unerwartetes – bisweilen auch unter Gefahr. Es verläuft sich, es verirrt sich, es verwundet sich, es spielt auch mal verrückt – es geht an die Grenzen. Allein oder mit anderen. Und nicht zufällig ereignen sich in diesem Reich der Freiheit dann auch spontan aufregende Dinge: Das Kind fährt plötzlich Fahrrad. Es raucht seine erste Zigarette. Es erlebt die ersten Küsse und durchleidet Liebeskummer. Nie werde ich vergessen, wie sich mein jüngster Sohn, damals kaum zehn, in das Zirkuskind Betty verliebte, das jeden Abend mit Federn bekleidet auf einem Kamel ritt. Eine Woche lang hat er den Zirkus begleitet, Abend für Abend, und ich bin sicher, er hat damals, als er Betty irgendwann aus den Augen verlor, eine erste und tiefe Ahnung von Liebeskummer und Liebesverlust durchlebt.
Eine Kinderregel: In der Schulzeit lernt das Kind Rechnen und Schreiben. In den Ferien darf es Buchstaben und Zahlen vergessen und lernt das Leben selbst. Und das Heilsame daran ist der zuverlässige Wechsel von beidem.
»Was ist bewegender als eine Liebesgeschichte mit einem Kind?«
Roberto Benigni
Ich kenne eine Frau, die den Film Ronja Räubertochter siebenmal im Kino gesehen hat. Es musste Kino sein! Nirgends, so meint sie, gibt es einen so ekstatischen Frühlingsschrei wie in diesem Film. Nicht einmal im wirklichen Leben selbst. Warum muss eine erwachsene Frau, Pfarrerin, Mutter von Töchtern, ins Kino gehen, um sich diese Sehnsucht nach dem archaischen Frühlingsschrei zu erfüllen? Warum genügt es nicht, das wunderbare Buch von Astrid Lindgren zu lesen? Warum muss es Kino sein?
Die Antwort ist einfach: Gute Filme gehen unter die Haut. Filmemacher haben ein sensibles und gleichzeitig scharfes Sensorium für den Menschen und was ihn umtreibt. Sie wagen sich vor und erspüren den Zeitgeist oft früher als andere. Und gleichzeitig wissen sie auch, dass die Seele des Menschen konservativ ist und sich deren Urbilder über die Zeiten hinweg immer gleichen. In diesem Spannungsfeld werden hochwertige Filme gemacht, und was das jeweils Besondere ausmacht, ist die Mischung dieser beiden Pole – abgesehen von der technischen und ästhetischen Qualität der Kamera. 90
Hinzukommt, dass Filmemacher eine besondere Wahrnehmungsart haben, die Dinge der Welt zu sehen, beziehungsweise nicht nur zu sehen, sondern auch innerlich aufzunehmen. Cineasten haben eine coenästhetische Wahrnehmung – wie Clowns, Musiker, Maler, Flieger, Akrobaten – und eben wie Kinder! Dem Psychoanalytiker und Kinderarzt René Spitz verdanken wir eine nähere Beschreibung dieser besonderen Art des Aufnehmens von Sinneseindrücken, die er als das früheste Kommunikationssystem des Menschen überhaupt beschreibt. Darin finden sich gebündelt »Gleichgewicht, Spannungen (der Muskulatur und andere), Körperhaltung, Temperatur, Vibration, Haut- und Körperkontakt, Rhythmus, Tempo, Dauer, Tonhöhe, Klangfarbe, Resonanz, Schall und wahrscheinlich noch eine Reihe anderer, die der Erwachsene kaum bemerkt, und die er gewiss nicht in Worte fassen kann«. 91 Das sind die Zeichen und Signale, innerhalb derer sich das neugeborene Menschenkind bewegt – das ist seine Sprache. Und das ist die Sprache der oben genannten Menschengruppen (Clowns, Musiker usw.) und die der modernen Filmemacher und Schauspieler. (René Spitz hat Letztere leider unterschlagen, dabei musste ihm zumindest Charlie Chaplin gut vertraut gewesen sein). Gerade sie wollen den Betrachter nicht (nur) auf der rationalen, sprachlich geordneten Wahrnehmungsebene erreichen, sondern auch in den tieferen Schichten der Emotionen. Hier einige Beispiele:
Kein Buch über Liebe und Bindung zwischen Vater und Kind berührt uns wie Charlie Chaplins Der Vagabund und das Kind ( The Kid , 1921). Keine Abhandlung über Scheidung lässt uns so mitleiden wie der Film Kramer gegen Kramer ( Kramer vs. Kramer , 1979). Im französischen Film Sie küssten und sie schlugen ihn ( Les 400 coups , François Truffaut, 1959) erfahren wir alles über schlechte Eltern, ignorante Lehrer, Kinosucht und die Notwendigkeit von Kinderlügen.
Die Verlassenheit und die Angst eines Kindes durchlebt man bei Oliver Twist , und zwar sowohl in dem alten englischen Meisterwerk von 1948 als auch in Roman Polanskis Verfilmung von 2005. Ein Gespür und zugleich Erschauern über die Folgen frühkindlicher Traumatisierung – hier die abrupte Trennung von den Eltern – vermittelt uns Orson Welles’ Meisterwerk Citizen Kane aus dem Jahre 1949. Eine Ahnung, wie ein nicht-erzogenes, sogenanntes wildes Kind fühlt – ja: fühlt –, bekommen wir angesichts der Regenszene in Der Wolfsjunge ( L’enfant sauvage , François Truffaut, 1970).
Читать дальше