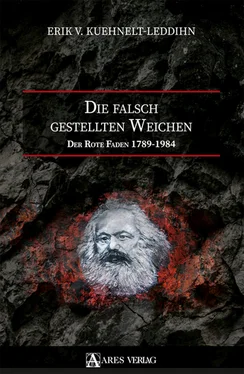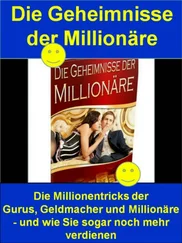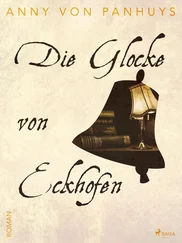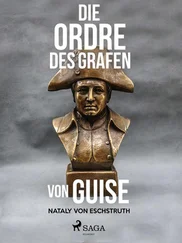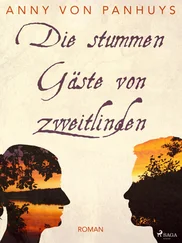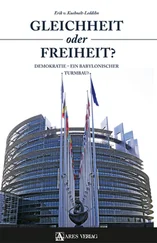Portugal war trotz seines immerhin noch ausgedehnten Kolonialreichs – Angola, Moçambique, Guinea, São Tomé, Macau, die Kapverdischen Inseln und das halbe Timor – wirtschaftlich und politisch so schwach, daß es praktisch eine Kolonie seines „ältesten Verbündeten“, also Großbritanniens, wurde. Die gewaltige finanzielle und militärische Überlegenheit des Nordens lastete auch auf Portugal schwer. In Spanien kam es nach der Niederlage durch die Amerikaner im Jahre 1898 zu einem intellektuell-literarischen Erwachen: Die „Generation von 98‘“ umfaßte Leute wie Unamuno, Pio Baroja, die beiden Brüder José und Eduardo Ortega y Gasset. Man empfand dort sein Land als „problematisch“ – España como problema; José Ortega schrieb nicht viel später auch sein España invertebrada . Doch Ähnliches ereignete sich auch in Portugal. Dort hatte ein britisches Ultimatum, als Folge des kolonialen Vorstoßes eines portugiesischen Forschungsreisenden in Afrika (Serpa Pinto), einen psychologischen nationalen Notstand hervorgerufen. Auf die Spitze getrieben wurde diese Krise durch eine britische Flottendemonstration an der Tejo-Mündung. Man darf da nicht vergessen, daß Portugal im 16. Jahrhundert das größte Kolonialreich der Welt von Brasilien bis Macau besessen und praktisch alle Ozeane regiert hatte, während England zu dieser Zeit noch ein rechter Seeräuberstaat war. 18)Der große portugiesische Dichter Tarquinio Anthero de Quental verübte bald daraufhin Selbstmord und schrieb zum Abschied:
„Ein englischer Staatsmann des letzten Jahrhunderts, der zweifellos auch ein kluger Beobachter und Philosoph gewesen war, Horace Walpole, hatte gesagt, daß für jene, die fühlen, das Leben eine Tragödie, für die aber, die denken, eine Komödie ist. Gut, wenn wir Portugiesen, die fühlen, tragisch zugrunde gehen müssen, so ist das ein edles Schicksal verglichen mit dem, das in vielleicht nicht allzu ferner Zukunft England beschieden sein wird, das elend und komödienhaft untergehen wird.“ 19)
Man muß allerdings bezweifeln, daß die Engländer berechnende Intellektualisten sind, aber Anthero de Quental hatte da etwas gesagt, was im Süden Europas sehr allgemein empfunden wurde.
Die Geschichte Portugals bis zum Sturz der Monarchie ist eine Spanien ähnliche: Revolten und Revolutionen, politische Morde, schwerste Finanzkrisen, alles getragen von der portugiesischen saudade , einer Mischung von Traurigkeit und unerklärlichem Heimweh. Portugal ist allerdings auch ein Land wuchtigster Schicksalsschläge, wie die spanische Herrschaft von 1580 bis 1640, die die Holländer weidlich ausnützten, 20)das fürchterliche Erdbeben von 1755, dem nicht nur das alte Lissabon zum Opfer fiel, sondern das auch eine tiefe Glaubenskrise hervorrief und das Régime des kirchenfeindlichen Marquis Pombal psychologisch erst möglich machte. Er war der große „aufgeklärte“ Verfolger der Jesuiten, die er einsperren ließ und die in nassen Gefängnissen elend zugrunde gingen. Auch die Zerstörung der jesuitischen Reducciones in Paraguay (von Brasilien aus) war sein Werk. Am Anfang des 19. Jahrhunderts kamen die Kriege zwischen den Briten unter Wellington und den Franzosen dazu, die von Spanien unter Napoleons Bruder Joseph ins Land eingedrungen waren. Wie auch anderswo zeichneten sich die französischen Truppen als tüchtige Plünderer aus. Auch Gotteshäuser verschonten sie nicht. Dann kamen die Kriege zwischen den Miguelisten und den Liberalen, schließlich die große Stagnation, die zu einer völligen Vernachlässigung der Kolonien führte. 1908 kam der Doppelmord an König und Kronprinz in der besten demo-linken Tradition, worauf der zweite Sohn des Königs, Manoel, ein halbes Kind, bis 1910 regierte. Es war dies die erste Gründung einer Republik am ganzen Erdball seit 1870. Doch wie überall folgte dem Ende der Monarchie eine endlose Kette von Pronunciamentos, Staatsbankrotten, Aufständen in einem nun vollends chaotischen Land. Die „europäischen“ Ideen wirkten sich in diesem einfachen, fleißigen, etwas melancholischen und skeptischen Volk ebenso fatal aus wie in Spanien.
19. DER „FORTSCHRITTLICHE“ NORDEN
Der Norden Europas, dem phänotypisch auch die Niederlande, wenn nicht gar Belgien zuzuzählen sind, ging indessen durch eine Periode relativen Wohlstands und einer gewissen Blüte. Zwar waren die skandinavischen Länder nicht annähernd so reich wie nach dem Ersten oder gar nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Niederlande zehrten einigermaßen von ihrem Kolonialreich, wenn auch keineswegs in dem Ausmaß, wie es der Laie annimmt. Und wer die Ziffern über den belgischen Kongo kennt – die Einnahmen, die Ausgaben, die Investitionen, die Dividenden – wird sehen, daß dieser afrikanische Besitz für Belgien viel eher eine Belastung als eine Quelle von Profiten war. Doch über den „Kolonialismus“ wollen wir noch später reden.
Während Dänemark in den Jahren 1814 bis 1940 durch zwei Kriege um Schleswig–Holstein erschüttert wurde, hatte Norwegen nur eine kleine Revolte (gegen das Haus Bernadotte und die Personalunion mit Schweden), und Schweden selbst keinen einzigen Krieg bis auf den heutigen Tag. Doch wenn auch das rein geistige Leben im hohen Norden keine sonderlichen Blüten trieb und weder überragende Philosophen noch Theologen hervorbrachte, so hatten doch die Dänen den höchst genialen Søren Kierkegaard, der in seinem eigenen Land kaum einen Widerhall fand und tatsächlich nur im Ausland, vorwiegend von katholischen Interpreten, gründlich studiert wurde. 1)Skandinavien produzierte einen großen Komponisten, Grieg, und das benachbarte Finnland einen anderen – Sibelius. Norwegen dazu einen großen Maler: Munch. Anders aber war es um die Literatur bestellt, denn da haben wir eine ganze Reihe von Männern und Frauen, die sich im goldenen Buch der Dichtung verewigt haben: Bjørnson, Ibsen, Lie, Hamsun, Strindberg, Lagerlöf, Jacobsen, Jørgensen, Undset, Stolpe, Stenius. 2)Im Vergleich zur Literatur in der italienischen Sprache (man bedenke, daß Norwegen, Dänemark und Schweden zusammen nur an die 16 Millionen Einwohner zählen) war das eine beachtenswerte Leistung. Umsomehr gab man sich aber dem materiellen Fortschritt hin: Die Demokratie, der Liberalismus und moderne Sozialideen florierten im hohen Norden wie auch in den Niederlanden. Dort hatte der Komfort im Rahmen einer hochbürgerlichen Kultur (mit sehr starkem Konfessions-und Klassenempfinden) eine wahre Spitze erreicht. In Belgien zeigten sich allerdings schon beträchtliche Spannungen zwischen dem französischen und dem flämischen Element.
Als sich Belgien 1830 von den Niederlanden losriß, war ein „Diktat“ des Wiener Kongresses zerbrochen. Seit der Reformation und der Teilung der Niederlande in eine überwiegend kalvinische Republik und in spanische, später österreichische Niederlande hatten sich der Norden und der Süden auseinandergelebt. Bei den „Generalstaaten“ blieben aber noch sehr viele Katholiken, die gewohnt waren als Niedervolk unter kalvinischer Herrschaft, als Bürger dritter Klasse, im Schatten zu leben. 3)Das konnte nach 1815 den Flamen und Wallonen nicht zugemutet werden, die schon vor der französischen Invasion gegen die kirchenreformatorischen Verfügungen Josephs II. heftig reagiert hatten. Was nun die Flamen und Wallonen im Aufstand von 1830 einte, war natürlicherweise der katholische Glauben – und selbstverständlich gab ihnen auch der Umstand, daß sie im „Vereinten Königreich“ damals als Katholiken die große Mehrheit bildeten – an die 70 Prozent der Bevölkerung – zusätzlichen Mut. Zudem war im 19. Jahrhundert „Belgien“ volkreicher als der ‚Norden‘.
Doch sprach auch die Oberschichte der Flamen französisch viel eher denn niederländisch. Es muß aber auch im gleichen Atem zugegeben werden, daß das Französische im Norden sehr verbreitet war und noch vor hundert Jahren die Gesellschaft in Limburg und Nord-Brabant häufig unter sich französisch konversierte. 4)Nun aber entstand in dem neuen Staat, der auf dem Boden der alten habsburgischen Niederlande stand und „Belgien“ (nach einem alten keltischen Volksstamm) genannt wurde und über den ein zum katholischen Glauben übergetretener König regierte, allmählich eine Spannung zwischen den beiden Volksgruppen – eine Spannung, die sowohl einen nationalen wie auch einen soziologischen Hintergrund hatte. Die Flamen wollten zunehmend, ihre Sprache nicht als „Niedersprache“, sondern dem Französischen ebenbürtig behandelt sehen. In der flämischen Gesellschaft wurde diese Forderung anfänglich nicht ernst genommen: Erst allmählich änderte sich auch in den Oberschichten diese Haltung. 5)Die Emanzipationsbewegung der Flamen hatte zum Teil aber auch einen religiösen Charakter. Am Papier waren die Flamen genau so katholische Christen wie die Wallonen, aber letztere (nicht zuletzt dank des Einflusses des benachbarten Frankreichs) standen im Schnitt weiter links als die Flamen, waren viel öfter liberal oder gar sozialistisch. Auch der Einfluß der Freimaurerei war bei ihnen größer. So kam es auch dazu, daß fast alle Betriebe in Belgien (und nicht auch zuletzt im belgischen Kongo) entweder „katholisch“ waren oder den frères , den „Brüdern“, gehörten. Freilich war diese Zweiteilung der sprachlichen nicht analog: So war zwar die Universität von Brüssel eine Institution der Freimaurer, während die Löwens rein katholisch war – aber doch sehr lange ausgesprochen französisch, dann „gemischt“ und schließlich sprachlich radikal geteilt. Da die flämische Geburtenziffer (als die „katholischere“) auch größer als die französische war, kamen die Flamen langsam aus ihrem „Minderheitsstadium“ und deshalb auch aus ihren Minderwertigkeitsgefühlen heraus und konnten es sich somit gestatten, recht aggressiv zu werden. Nur war dies ein sehr langsamer Prozeß, der bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs keineswegs abgeschlossen war. Oft sahen schon damals viele Flamen eher in den Deutschen Eroberern als in den Wallonen ihre Brüder. Die Loyalitäten zerrissen oft die Familien. 6)Das Zeitalter der Ziffern, der Wahlen, der Volksvertretungen und des Nationalismus hatte überall seine fatale Wirkung.
Читать дальше