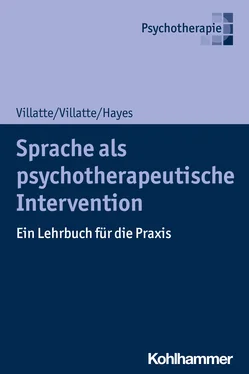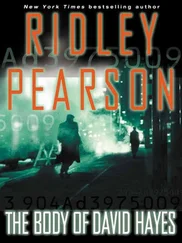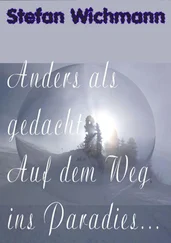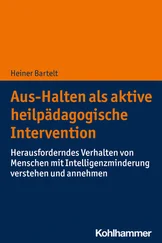Das Verändern von einzelnen Elementen des therapeutischen Kontextes, einschließlich der Sprache, kann das Erleben der Patientin erheblich verändern. Dies beeinflusst auch Ebenen, die Psychotherapeuten nicht direkt zugänglich sind, wie die physiologische, kognitive, emotionale oder motivationale Ebene. Dies gibt die Macht, Veränderung zu erzeugen, fest in die Hände des Therapeuten und des Patienten. Sie können die Mechanismen der Veränderung in der Therapie identifizieren und gezielt beeinflussen. Dies ermöglicht besonders effiziente Interventionen, die ein breites Spektrum therapeutischer Ziele beeinflussen, indem sie zentrale behaviorale Prozesse und Funktionen ansprechen, anstatt sich auf spezifische Formen von Gedanken, Emotionen oder Verhalten zu beschränken.
Das Buch hat folgende allgemeine Ziele: Therapeuten und ihre Patienten sollen befähigt werden, 1) zu identifizieren, welche kontextuellen Elemente ihr Verhalten beeinflussen und 2) die Kraft der Sprache zu nutzen, um den Kontext so zu verändern, dass er adaptives Verhalten begünstigt. Unser Ansatz basiert auf einer kontextuell-verhaltenswissenschaftlichen Theorie von Sprache und Kognition, der Bezugsrahmentheorie (Relational Frame Theory, RFT; Hayes, Barnes-Holmes & Roche, 2001). RFT gründet sich auf einem dynamischen Forschungsprogramm. In diesem Zusammenhang sind bereits über 150 empirische Publikationen entstanden. Sie betreffen die Bereiche Psychopathologie, Theory of Mind, implizite kognitive Prozesse, Intelligenz, regelgeleitetes Verhalten, Problemlösen, Selbstkonzept und andere für die Behandlung von Patienten wichtige Themen (Dymond & Roche, 2013). Die Grundsätze von RFT werden bereits erfolgreich in folgenden Bereichen angewandt: Förderung von Bildung, Behandlung von entwicklungsbedingten Beeinträchtigungen, Gesundheitsverhalten, Verminderung von Risikoverhalten, Leistungssteigerung, Behandlung von Problemen in intimen Beziehungen, Organisationsmanagement, Förderung von kulturellen und sozialen Transformationsprozessen. Akzeptanz- und Commitment Therapie (ACT; Hayes, Strosahl & Wilson, 1999, 2012) ist die erste Psychotherapie, die sich explizit auf RFT bezieht. ACT ist eine evidenzbasierte Behandlungsmethode für ein breites Spektrum von Gesundheitsproblemen (siehe Liste der evidenzbasierten Programme der American Psychological Association, Division 12 und der U.S. Substance Abuse and Mental Health Services Administration). Das vorliegende Buch ist allerdings kein ACT-Manual. Es soll keinen neuen, besseren Weg beschreiben, ACT anzuwenden. Es behauptet auch nicht, dass Sie ACT erlernen müssen, um RFT bei Ihren Patienten anzuwenden. Es soll weder ACT noch irgendeine andere Behandlungsmethode ersetzen. Es ist die Absicht dieses Buches, Prinzipien zu erkunden und zu erläutern, die für einen gemeinsamen elementaren Mechanismus aller Psychotherapiemethoden gelten – Sprache.
1.3 Sprache ist erlerntes Verhalten
1.3.1 Aufbau von und Reagieren auf symbolische(n) Beziehungen
Der moderne Mensch existiert seit weniger als 200.000 Jahren (McDougall, Brown & Fleagle, 2005). Die meisten psychologischen Prozesse, die Auswirkungen auf uns haben, sind jedoch viel älter. Die Lernprozesse der operanten und klassischen Konditionierung sind vermutlich mehr als 500 Millionen Jahre alt (Ginsberg & Jablonka, 2010); Habituation ist noch älter. Sprache dagegen ist möglicherweise erst vor 100.000 Jahren entstanden (Nichols, 1992). Selbst wenn Sprache – wie einige vorbringen – auf die Zeit zurückgehen sollte, als sich die Hominiden entwicklungsgeschichtlich von den Schimpansen trennten, wäre sie trotz allem eine relativ junge Entwicklung. Fünf Millionen Jahre sind nur ein Augenblick auf dem Zeitstrahl der Evolution.
Irgendwann in den letzten paar hunderttausend Jahren begann der moderne Mensch, symbolische Beziehungen zu konstruieren, die es ihm erlaubten, mental Dinge zusammenzufügen oder sie voneinander zu trennen; Ähnlichkeiten zu erkennen und Unterschiede festzustellen; Analogien herzustellen und Ergebnisse vorauszusagen. Aus bescheidenen Anfängen, die darin bestanden, Dingen Namen zu geben, ist eine Sammlung erstaunlicher und einzigartiger menschlicher Fähigkeiten entstanden – zu analysieren und zu planen, Werte festzulegen und zu vergleichen, sich Szenarien einer Zukunft vorzustellen, die noch niemals erlebt worden sind, sich seiner selbst bewusst zu sein oder sich in die Sichtweise anderer hineinzuversetzen. Diese Verhaltensweisen werden in anderen Konventionen auch symbolisches Verhalten, kognitive Prozesse höherer Ordnungen oder Exekutivfunktionen genannt. Wir nennen sie Sprache.
Im alltäglichen Gebrauch wird der Begriff Sprache üblicherweise für die Fähigkeit zu kommunizieren verwendet. In diesem Buch verwenden wir den Begriff in einem wesentlich umfassenderen Sinn. Wir definieren Sprache zunächst als die erlernte Fähigkeit, Beziehungen zwischen Objekten und Ereignissen aufzubauen und uns in Übereinstimmung mit diesen Beziehungen zu verhalten, die teilweise auf der Grundlage sozial etablierter Hinweisreize entstehen. Der letzte Satz besagt lediglich, dass diese Beziehungen nicht nur auf intrinsischen 2 2 Mit intrinsisch meinen wir nicht »unabhängig von unserer Wahrnehmung«, sondern »unabhängig von unserer symbolischen Interpretation«. Demnach ist, im Kontext dieser Definition, die Farbe einer Rose, die wir als rot sehen, intrinsisch, weil sie nicht von Sprache abhängt, sondern von unserer Wahrnehmung (einige Tiere oder Menschen mit beeinträchtigter Sehfähigkeit sehen sie anders). 3 Obwohl der Begriff »verbal« in der Behaviorismus-Literatur zum Thema Sprache als Synonym für das Wort »symbolisch« genutzt wird, nutzen wir diesen Begriff in diesem Buch nur, wenn es sich auf Symbole bezieht, die aus Wörtern bestehen, um dadurch eine Verwechslung für Leser zu vermeiden, die mit dieser Literatur nicht vertraut sind. Nach unserer Definition können auch non-verbale Reize symbolisch sein (z. B. Gesten, Piktogramme). Wir nennen nicht-symbolische Hinweisreize und Funktionen »intrinsisch«. Wenn wir jedoch den Begriff »verbale Interaktion« nutzen, dann beziehen wir uns im Allgemeinen auf symbolische Interaktionen (einschließlich Gesten, Körperhaltungen, Gesichtsausdrücke, Ton der Stimme usw.), um der allgemeineren Verwendung dieses Begriffes zu entsprechen. 4 Technisch gesehen ist es allerdings niemals vollkommen »gratis«, weil wir uns auf den Prozess der Ableitung einlassen müssen. Sobald dieser Prozess aber erlernt und gut verinnerlicht wurde, erfolgt er so schnell und natürlich, dass er sich automatisiert und mühelos anfühlt, wenn die Beziehungen, die hergeleitet werden sollen, relativ einfach sind. Wenn wir versuchen, ein komplexes Problem zu lösen, erleben wir den Prozess der Ableitung meist als sehr anstrengend. 5 In diesem Buch steht »<���« für »kleiner als oder weniger als« und »>« steht für »größer als oder mehr als«. 6 Gelegentlich weiten wir den Begriff »Sprache« um den Zusatz »Kognition« aus, um Sie daran zu erinnern, dass aus der Sicht der Relational Frame Theory das Denken und das Sprechen dem Aufbau von und dem Reagieren auf symbolische Beziehungen entspricht.
Merkmalen der Dinge beruhen, auf die Bezug genommen wird. Wenn wir Ihnen mitteilen würden: »Das ist Alfred«, lernen Sie, dass diese zwei Dinge (die Person und der Name) dasselbe sind. Dieses Wissen beeinflusst, wie Sie auf beides reagieren. Zum Beispiel würden Sie die Person ansehen, wenn Sie den Namen hören. Dennoch gibt es keinerlei vorgegebene Übereinstimmung zwischen der Person und dem Namen. Die Beziehung ist symbolisch und basiert auf dem kleinen Wort »ist«. Der Hinweisreiz (d. h. ist) gibt nun vor, wie Sie auf die Person und den Namen reagieren sollen. Dieses Vorgehen basiert auf einer sozialen Konvention. Die Bedeutung dieses Hinweisreizes muss erlernt werden und hängt davon ab, wer spricht und wer zuhört. Auf der einen Seite hat das Wort »ist« eine bestimmte Bedeutung für deutschsprachige Personen. Denn Sie würden durch diese sprachliche Auskunft nichts über die Person und den Namen lernen, wenn Sie keine Kenntnisse der deutschen Sprache erworben hätten. Andererseits steckt in dem Wort »ist« nichts Außergewöhnliches. Es wäre Ihnen auch möglich, einen Bezug zwischen dem Namen und der Person herzustellen, wenn wir Ihnen ein vollkommen anderes Set an sozial codierten Hinweisreizen anbieten (»C’est Alfred«) natürlich vorausgesetzt, Sie haben Französisch gelernt. Das meinen wir, wenn wir durch soziale Konventionen definierte Hinweisreize als Symbole bezeichnen und Beziehungen, die auf diesen willkürlich anwendbaren Hinweisreizen beruhen, als symbolische Beziehungen bezeichnen. Mit diesem Hintergrundwissen können wir unsere Definition vereinfachen: Sprache ist das erlernte Verhalten, das symbolische Beziehungen aufbaut und auf sie reagiert.
Читать дальше