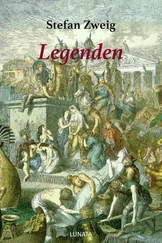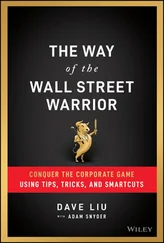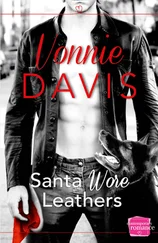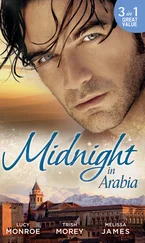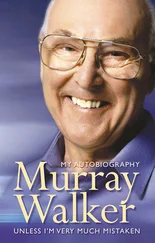»Fuck!«
Moment. Da war noch ein Geräusch zu hören. Ein Wimmern …
»Cam? Kannst du mich hören?« Terry blieb wie angewurzelt stehen, lauschte nach seinem Freund und versuchte die Panik zu unterdrücken, die sich in seinen Eingeweiden ausbreitete. Totenstille. Cam muss bewusstlos sein. Terry hoffte, dass es nichts Ernstes sein würde. Er beschleunigte sein Tempo, versuchte sich seinen Weg durch die Finsternis zu bahnen, aber in Gedanken war er bereits woanders. Wie sollten sie wieder aus dem Busch kommen, wenn Cam verletzt war? Wahrscheinlich blieb ihnen nichts anderes übrig, als die Köpfe einzuziehen und ein Such- und Rettungsteam anzufordern. Vorausgesetzt, dass sie hier draußen Empfang haben würden. Aber selbst wenn sie durchkämen und jemanden erreichten, hatte Terry keine Ahnung, wo sie sich gerade befanden. Der Waldpark erstreckte sich über mehr als zweitausend Quadratkilometer. Es würde Tage dauern, bis man sie fand.
Terry schüttelte den Kopf, verärgert darüber, dass seine Fantasie mit ihm durchging. Zuerst einmal musste er Cam finden. Darüber, wie er ihn aus dem Wald schaffen konnte, würde er später nachdenken.
Am Rand ihres Lagers stolperte Terry über einen umgestürzten Baumstamm, schrammte sich das Kinn auf und landete mit dem Kopf voran in einem schwammigen Farngestrüpp. Benommen und verwirrt rappelte er sich wieder auf und tastete im Dunkeln nach dem Hindernis, um nicht ein zweites Mal darüberzufallen. Seine Finger berührten einen Stiefel. Terry spürte einen Anfall von Erleichterung. Cam war offenbar über den gleichen Stamm gestolpert.
»Cam«, rief er erleichtert. »Is‘ schon okay, Kumpel, ich hab dich gefunden. Alles wird gut.«
Cam antwortete ihm nicht und bestätigte damit Terrys Vermutung. Der Trottel war herumgelaufen und hatte sich selbst an einem Felsbrocken oder einem Baumstumpf oder so die Lichter ausgeschossen, eine Gehirnerschütterung geholt. Terry tastete Cams Beine nach oben ab und stellte dabei erleichtert fest, dass zumindest keine Knochen gebrochen waren.
Was zum Teufel?
Terry begann zu schlottern, als sein Körper bereits erkannte, was sein Geist noch zu verstehen versuchte. Er hob seine Finger an sein Gesicht und schnüffelte an dem feuchten Film, der dort kleben geblieben war. Metallisch. Das war kein Tau. Entsetzt riss Terry seine Hände zurück. Cams Oberkörper fehlte.
»Heilige Jungfrau Maria!«
Cam war in der Mitte halbiert worden. Terry, der nach Luft rang, sprang auf die Füße, taumelte zurück, taste mit seinen blutigen Händen um sich, während ein leises Wimmern in ihm aufstieg. Wie konnte das passieren? Aber er würde nicht darauf warten, es herauszufinden. Er musste so schnell wie möglich von hier verschwinden.
Terry kehrte dem Rest von dem, was von Cam noch übrig war, den Rücken zu und stürmte zu dem Zelt zurück, stürzte sich kopfüber in die Dunkelheit und ignorierte dabei die Zweige, die ihm ins Gesicht und gegen seine Arme stachen. Er hatte die Hälfte der Lichtung überquert, als der Mond durch das Laubdach des Waldes lugte, den Zeltplatz erhellte und Terry klar wurde, dass der Weg aus dem Urwald seine geringste Sorge sein würde.
Maungapōhatu, Te Urewera, Ende März
Rawiri Temera saß in einem zusammenklappbaren Strandkorb auf der hinteren Veranda des Farmhauses, rauchte eine Zigarette und lauschte dem vertrauten Geschnatter der Kuckuckskäuze und der Wekarallen. In manchen Nächten konnte Temera von diesem Punkt aus die zerklüftete Silhouette des Te Maunga vor dem dunklen Nachthimmel erkennen, den äußersten Gipfel der Huiarau-Gebirgskette der Urewera-Region. Heute Nacht aber hatte Hinepūkohurangi, die Jungfrau des Nebels, das Bergmassiv mit ihrem grauen Schleier eingehüllt, und der Geruch von Temeras Tabak überdeckte ihr erdiges Parfüm.
Wie viele Nächte er wohl noch auf dieser Veranda verbringen würde? Nicht mehr viele – so die Überzeugung seines Großneffen Wayne – wenn Temera nicht mit dem Rauchen aufhören würde. Er aber ignorierte den Rat seines Neffen. Zumindest ein Laster sollte einem Mann vergönnt sein. Und mit dreiundachtzig Jahren waren ihm nicht mehr sehr viele Freuden im Leben geblieben. Selbst die Fahrt ins Tal und zurück erschien ihm mittlerweile als eine Qual, denn das Holpern des Lasters rüttelte ihn stets bis auf die Knochen durch und ließ ihn mit den Zähnen klappern. Vielleicht würde dies der letzte Besuch seines kāinga tipu sein, des abgeschiedenen Familiensitzes.
Temera schnippte etwas Asche in den Garten, schürzte die Lippen wie ein Klarinettenspieler, atmete geräuschvoll aus und streckte dabei seine Beine. In der Ferne hörte er etwas, das sich nach einem Motorengeräusch anhörte, aber er erwartete niemanden. Maungapōhatu lag viel zu weit abseits der ausgetretenen Touristenpfade, als dass hier Besucher für eine Tasse Tee und Ingwerplätzchen aufgetaucht wären. Es war alles andere als eine Touristenattraktion, nur eine Handvoll zäher Farmer, hauptsächlich raue Tūhoe-Männer und noch weniger Frauen. Die Verlorenen und die Einsamen. Vor zwei Jahren kreiste einmal ein Rettungshubschrauber beinahe eine Stunde lang über ihrer Siedlung und suchte nach einem dämlichen Jäger, der sich von seiner Gruppe getrennt hatte, um einem verwundeten Hirsch nachzujagen. Das war das größte Tamtam gewesen, dass sie in dieser Gegend erlebt hatten, seit sich der alte Kriegshäuptling Murakareke im Schlaf auf die Seite gewälzt und dabei seine Kronjuwelen im Feuer versengt hatte. Temera drückte seine Zigarette in einer alten Muschelschale aus, lehnte sich in seinem Strandkorb zurück und schloss die Augen …
Der Kuckuckskauz schrie. Der Ruf der Eule drang melancholisch aus der Ferne heran. Aus der dunklen Masse des Waldes tauchte ein Umriss auf, wurde immer größer, als hätte sich der Berg selbst losgerissen und würde nun ins Tal stürzen. Seine wechselhafte Form kam näher, bis sie nur noch wenige Meter von seinem Haus trennten und ihr Schatten über den Garten fiel.
Ein Taniwha, ein Monster aus den Legenden.
Temera wusste, dass die Anwesenheit des Taniwha bedeuten musste, dass er träumte. Noch nie zuvor hatte er einen Taniwha gesehen, aber er hatte genug von ihnen gehört, um ihn zu erkennen, wenn er ihn vor sich sah, Dunkelheit hin oder her. Hier in Kupes Wahlheimat kannte jedes Kind die Geschichten über die Taniwha – rachsüchtige Monster, die Krieger abschlachteten, Jungfrauen entführten und Babys mit Haut und Haaren verspeisten. Schauergeschichten, die Großmütter ihren Kindern immer und immer wieder erzählten. Aber Taniwhas waren nicht nur räuberisch – sie konnten auch Beschützer sein, wachten über Flüsse und Berge und bewahrten die Stammesangehörigen vor Schaden, indem sie sie vor drohenden Gefahren warnten.
Und dieser Taniwha? War er ein Freund oder ein Feind?
Zumindest erinnerte sich Temera noch, was er zu tun hatte. Leise atmete er aus und murmelte dabei einige Worte der Ehrfurcht. Ein Karakia-Gebet, zu Ehren seines Besuchers.
Landsafe Laboratories, Hamilton, Anfang Juni
Das dumpfe Knallen der Türen war zu hören. Jules schob sich von ihrem Computer zurück und sah den Gang des Labors hinunter. Es war Richard, ihr Boss. Die schwere Doppeltür schwang hinter ihm zu, während er mit zwei Kaffeebechern in der Hand auf sie zukam. Graubraune Haare fielen ihm übers Gesicht, er lächelte. Mit seinen Gummisohlen, die über das polierte Linoleum quietschten, hätte man Richard nur schwerlich für den CEO des Crown Research Institutes gehalten. Er war eher der Typ Versicherungsvertreter oder Verwaltungsangestellter, oder vielleicht sogar Comedian, obwohl seine einzigen Stand-ups während wissenschaftlicher Symposien stattfanden, etwa viermal im Jahr. Er war ein wirklich guter Wissenschaftler, mit einem Doktortitel aus Canterbury, Post-Doktorandenstellen an den Universitäten von Texas und Cambridge, Mitgliedschaften in einigen der angesehensten wissenschaftlichen Komitees und ökologischer praktischer Erfahrung auf drei Kontinenten.
Читать дальше