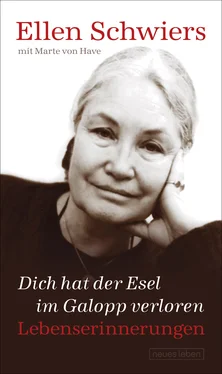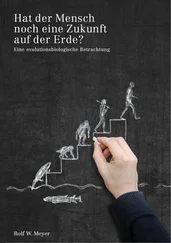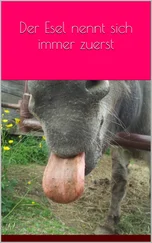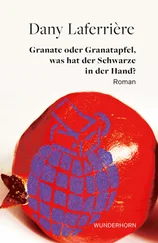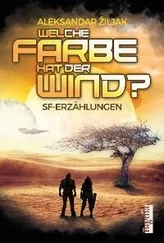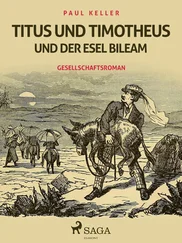Als Vater und ich nach Hause kamen, sahen wir, dass sämtliche Fenster des Hauses kaputt waren. Die ganze Hausgemeinschaft saß im ersten Stock zusammen. Damit sich alle etwas beruhigten, hatte jemand Schnaps ausgegeben. Alle starrten uns an, und meine Mutter schrie entsetzt: »Ellen, wie siehst du denn aus?« Bis zu den Knien war ich voller Blut, eigenem und fremdem. Da brach ich mit einem Weinkrampf zusammen: »Mami, ich habe auf Toten gestanden.« Ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Irgendjemand hat mir schließlich eine Beruhigungsspritze gegeben, meine blutenden Füße desinfiziert und die tiefsten Schnitte genäht.
Bis heute habe ich den toten kleinen Jungen mit dem Essgeschirr vor Augen und bin immer wieder mitten im Geschehen. Es ist nicht zu verarbeiten.
Nach jedem Bombenangriff musste ich mich als BDM-Mädchen in der Steinschule zum Appell melden. Wir mussten Verschüttete aus den Kellern ausbuddeln. Sie lagen, vom Staub und Schutt weiß wie die Mehlwürmer, in den Trümmern. Wenn alle überlebt hatten, waren das glückliche Momente. Innerlich wappnete man sich stets dagegen, auch auf Leichen zu treffen. Wenn das der Fall war, hörten wir mit dem Graben auf und es kamen erwachsene Helfer dazu. Die Leichen zu sehen war grauenvoll. Aber man musste funktionieren, musste den Schrecken mit sich selbst ausmachen. Wir mussten aufräumen! Es war so. Es war Krieg. Die geborgenen Toten wurden nebeneinander gereiht. Manche hatten keine Gliedmaßen mehr. Dann legte man ihnen die Arme oder Beine, die man fand, auf den Bauch.
Der Tod war für mich entsetzlich. Zerfetzte Leiber, aufgerissene Augen, aufgerissene Münder. Bloß nicht sterben, dachte ich – bloß nie sterben. Den ersten »normal«, also nicht im Krieg gestorbenen Menschen sah ich 1954 in Göttingen. Das war mein Kollege Siegfried Breuer. So kann der Tod also auch sein, dachte ich. So friedlich und schön.
Koblenz war eine Brückenstadt und damit ein strategisches Angriffsziel für die Engländer und ab dem Eintritt der Amerikaner in den Krieg auch für diese. Die Brücken wurden durch silberne Sperrballons geschützt, die von dünnen eisernen Seilen gehalten, höhenverstellbar bis an die sechstausend Meter hoch in den Himmel ragen konnten. Ihr Zweck war es, feindlichen Piloten den Anflug auf die Brücken und umliegenden Bodenziele zu erschweren, denn sie zwangen dazu, in größerer Höhe zu fliegen, was sich auf die Treffgenauigkeit auswirkte. Manchmal konnten die angreifenden Flugzeuge durch sie sogar zum Absturz gebracht werden, wenn die Piloten ihnen nicht mehr ausweichen konnten, zumal sie bei Nacht nicht sichtbar waren. Da die feindlichen Flieger in den letzten Kriegsjahren sehr oft angriffen, war das Aufsteigen der großen, mit Traggas gefüllten Ballons das Zeichen für einen baldigen Angriff, noch bevor wir Fliegeralarm bekamen.
Die Bombenangriffe der Amerikaner und Engländer hörten bald überhaupt nicht mehr auf. Am Ende des Krieges war Koblenz zu mehr als neunzig Prozent zerstört. Wir haben fast nur noch im Keller gelebt, denn andauernd gab es Fliegeralarm. Große Teile der Stadt lagen in Schutt und Asche. Doch auf wundersame Weise stand die Schwerzstraße, in der wir wohnten, noch. Aber wir ahnten, dass wir wohl bald als Nächstes dran waren und dass auch die Luftschutzkeller letztlich keine Sicherheit boten. Ich hatte ja selbst erlebt, dass die Menschen in ihnen verschüttet wurden und starben. Meine Freundin Meta Jost hatten wir aus so einem Keller ausgegraben. Sie sah aus wie ein Geist. Gesicht und Körper waren vom Staub der Steintrümmer wie bemehlt. Ihre Großmutter war tot, und Meta brachte kein Wort mehr heraus. Sie stand unter Schock und weinte um ihr Kaninchen.
Meine Mutter beschloss, Koblenz mit uns Kindern zu verlassen. Sie machte sich auf den Weg zur Steinschule, denn dort musste sie uns abmelden, um für die Reise Lebensmittelkarten zu erhalten. Kaum war meine Mutter losgegangen, erfolgte ein schwerer Luftangriff. Die Bomben schlugen genau im Gebiet der Steinschule ein, also dort, wo meine Mutter sich gerade aufhielt. Ich war sicher, dass ich sie nie wiedersehen würde. Nicht weit von uns entfernt hatte ein Kohlelager angefangen zu brennen. Die Luft war voller glühender Asche, und brennende Kohlenstücke landeten auf unserem Hausdach. Es drohte Feuer zu fangen. Außer meinem kleinen Bruder Gösta und mir war niemand mehr im Haus. Unsere Wohnung lag im obersten Stock. Also sind wir hinaus aufs Dach geklettert, um zu löschen. Gösta musste mir aus der Badewanne Wasser bringen – zu der Zeit sollten die Badewannen immer voller Wasser sein –, und ich habe mit langen Stangen, um die ich nasse Lappen wickelte, versucht, die Brandnester zu löschen.
Vom Dach aus sah ich meine Mutter auf der Straße um die Ecke biegen. Da bin ich fast ohnmächtig geworden, so glücklich war ich, dass sie noch lebte.
Sofort begannen wir unsere Habseligkeiten zu sortieren und zu packen. Man konnte seinen Besitz in der Festung Ehrenbreitstein deponieren, aber wir trauten dem System nicht. Daher ließen wir unsere Möbel in der Wohnung stehen und verstauten unsere persönlichen Dinge in einer Kiste im Keller. Nur mit Handgepäck und einem Köfferchen mit Silberbesteck verließen wir Koblenz. Das Besteck stammte aus dem Zietlower Haushalt meiner Großeltern und war der einzige Wertgegenstand, den wir aus unserer Wohnung mitnahmen. Wir hüteten es wie unseren Augapfel. Später stellte sich heraus, dass es sich um ein »nur« versilbertes Besteck handelte. Das war aber nicht weiter schlimm, hatte es für uns doch vor allem einen ideellen Wert.
Mein Großvater väterlicherseits organisierte, dass ich nach Niesky auf die Internatsschule der evangelischen Brüdergemeinde kam. Die Schwester meines Vaters, Tante Agnes, arbeitete dort als Sportlehrerin. Ich wurde alleine in die Bahn gesetzt. Wenn ich mir das heute überlege, finde ich es unglaublich. Niemals hätte ich eines meiner Kinder alleine, mitten im Krieg, quer durch ganz Deutschland geschickt. Doch meine Eltern hatten das schon einmal getan und mich als Elfjährige zusammen mit meinem damals fünf Jahre alten Bruder »verschickt«, nach Königsberg zu Tante Grete, einer Cousine meiner Mutter, und Onkel Max, ihrem Mann. Dort blieben wir ungefähr drei Monate. Es war der Stalingradsommer 1942. Ich sehe meine Eltern noch gemeinsam am Bahnsteig stehen, um uns zu verabschieden. Mein Vater war kurz zuvor für ein paar Tage auf Urlaub gekommen. In dem rappelvollen Zug musste ich stehen. Bis Berlin sind wir noch begleitet worden, danach wurden wir uns selbst überlassen. Wir mussten umsteigen und uns durchfragen. Als wir endlich in Königsberg ankamen, nahm uns dort niemand in Empfang. Meine Tante hatte sich verspätet. Diese vierzig Minuten, die wir Kinder alleine, völlig übermüdet auf dem Bahnhof standen und nicht wussten, ob noch jemand käme, um uns abzuholen, waren eine harte Prüfung.
Ich war nun im Internat, und meine Mutter und mein Bruder landeten bei zwei weiteren Cousinen meiner Mutter in Leipzig, den Zwillingsschwestern Erika und Eva. Tante Erika war Kriegswitwe und hatte vier Kinder zu versorgen. Tante Eva hatte zwei Kinder. Ihr Mann, der Wirtschaftshistoriker Professor Friedrich Lütge, stand dem Kreisauer Kreis, einer bürgerlichen Widerstandsgruppe, nahe. Das wusste aber keiner, zumindest meine Mutter wusste es nicht.
Es war Juli 1944, die Front rückte immer näher und die beiden Schwestern machten sich auf nach Königsberg, um ihre alte Mutter zu holen. In der Zeit ihrer Abwesenheit führte meine Mutter dem Professor und den nun insgesamt acht Kindern den Haushalt. Als am 20. Juli 1944 das Attentat auf Hitler scheiterte, war der Professor plötzlich verschwunden. Einige Kreisauer hatten sich der Widerstandsgruppe um den Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg angeschlossen, nachdem Anfang 1944 einer der Gründer des Kreisauer Kreises, Helmuth James Graf von Moltke, verhaftet worden war. Es dauerte nicht lange, da stand die Gestapo vor der Wohnungstür, um den Professor zu verhaften, fand aber nur eine Frau und acht Kinder vor. Sie nahmen meine Mutter, die keine Ahnung hatte, wo sich der Professor aufhielt, kurzerhand mit und brachten sie in einen Keller zum Verhör. Sie hat, nach dem, was sie uns später erzählte, den Ernst der Lage gar nicht begriffen, sondern sich stattdessen lautstark darüber beschwert, dass eine grelle Lampe auf sie gerichtet war und dass sie, eine Dame, diesem grauenvollen Licht ausgesetzt wurde. Sie haben sie tatsächlich wieder ziehen lassen. Ich glaube, ihre Naivität hat ihr das Leben gerettet.
Читать дальше