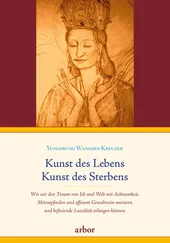Im Neuen Testament heißt es in Markus 8:35, in dieser Welt zu sterben, bedeute, das ewige Leben zu erlangen: »Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten.« Wie schön sie ist, die Vorstellung, auf dem Fahrrad zu sitzen, in Bewegung zu sein und dabei eine feststehende und ewige Gegenwart zu erleben, leer und befreit von uns selbst (in gewisser Weise also »tot«) – während uns die Zukunft entgegenkommt und mit all ihrer Launenhaftigkeit in sich aufsaugt.
Wie gesagt enthält dieses Buch Nahrung und Poesie für den Geist. Die Lektüre bewegte mich dazu, noch einmal das Gedicht Shinjinmei (auf Deutsch etwa »Glaubensgeist«) von Meister Sengcan zu lesen, dem dritten Zen-Patriarchen. Wieder einmal war ich vollkommen hingerissen von diesem wunderbaren und geheimnisvollen Gedicht: »Wenn du noch die kleinste Unterscheidung triffst, werden Himmel und Erde unendlich weit voneinander getrennt«, so heißt es darin über das Thema Reinigung.
Was Singularitäten, Unterscheidungen oder Bewertungen hervorbringt, ist das Denken, das sich vom »kontemplativen« Denken entfernt, um mit seiner konzeptuellen Axt die Realität zu unterteilen (um nicht zu sagen: zu zerstückeln). Auf diese Weise hören Himmel und Erde, Licht und Dunkel, Oben und Unten, Form und Leere auf, ein und dasselbe zu sein. Wir treten ein in die Dualität, die Dichotomie, die Dialektik. Das »Ich« etabliert sich und errichtet sich selbst dabei ein Gefängnis. Zen ist Methode und Ziel zugleich. Es ist kein Mittel zum Zweck, sondern Mittel und Zweck gleichermaßen. Es trägt das Potenzial in sich, die Wände unseres persönlichen Kerkers niederzureißen.
Und noch einen Aspekt hat dieses Buch – den der Erinnerungen: So führte es mich zurück in meine Vergangenheit mit Zen. Wenn ich an kalten und langweiligen Abenden in Pamplona die dummen Baracken verlassen durfte, in denen ich meinen dummen Militärdienst ableistete, las ich Suzuki Shunryū. Ich bin sicher, dass ich damals nicht viel davon begriff, aber das war mir gleich, weil mir die bloße Lektüre schon das Gefühl gab, lebendiger zu sein, stärker bei mir selbst oder etwas in der Art, und es war ein wirksames Gegenmittel für die Zeitverschwendung und Bedeutungslosigkeit meines Militärdienstes. Heute glaube ich, dass ich damals, ohne mir dessen vollständig bewusst zu sein, durch das Verlangen nach Transzendenz und Weisheit motiviert wurde, das meiner Ansicht nach in uns allen lebt und pocht.
Die Lektüre führte mich aber auch zurück in meine Vergangenheit mit Fahrrädern: Beim Lesen fluteten mich Erinnerungen an meine Kindheit auf dem Land. Meine Familie war sehr, sehr groß, und ich erinnere mich deutlich an das eine kleine Kinderfahrrad, das in dem Bauernhaus meiner Großeltern stand, und die Gefühle, die ich mit ihm verband. Es wurde von einer gewaltigen Anzahl an Cousins und Cousinen benutzt, die alle ihre dreihundert ruhmreichen Meter darauf fahren wollten, ehe sie es voller Bedauern, Unwillen und Neid an das nächste Kind weiterreichen mussten. So viele Geschwister, Cousins und Cousinen, wie wir waren, mussten wir zwangsläufig Großzügigkeit, Respekt und Teilen lernen. Aber das Verlangen und das Vergnügen, die mit dem Fahren auf diesem Rad einhergingen, waren unbeschreiblich: den Weg entlang zu strampeln, flankiert von Mandelbäumen und Schilf, bis man die Grenze des Sicheren und Erlaubten erreichte: die Bahnschienen, die durch das kleine Dorf verliefen.
Auch an das gigantische, gelborange lackierte alte Fahrrad meines Großvaters musste ich wieder denken. Wenn wir vor dem Café beim Park, in dem er immer Kaffee trank und Karten spielte, sein Fahrrad entdeckten, liefen wir manchmal los, um ihn zu fragen, ob wir damit herumfahren durften. Wir mussten erst auf den Rahmen klettern, um den Sattel zu erreichen und in die Pedale treten zu können, natürlich ebenfalls wieder abwechselnd. Später, in meiner Jugend, erlebte ich das wunderbare Vergnügen, mit einer Gruppe von Freunden auf den Wegen herumzufahren, die die Felder umgeben.
Heute fällt mir auf, dass ich mir erst als Erwachsener mein erstes eigenes Fahrrad kaufte, in Barcelona, als ich zwanzig war. Ich muss zugeben, dass ich es mit der Angst bekam, nachdem ich es eine kurze Zeit im Stadtverkehr benutzt hatte und überzeugt war, dass es eine konkrete Gefahr für mein Leben darstellte. Zum Glück haben sich die Zeiten geändert, und heute gibt es mehr und mehr Fahrradwege und mehr und mehr Menschen, die sich mit dem Rad in den Stadtverkehr trauen. Was sie lockt, sind die Stressreduktion und die gesundheitlichen Vorteile, die mit dem Radfahren einhergehen, wofür inzwischen auch viele Städte ein Bewusstsein gewonnen haben.
Ich danke Juan Carlos für seine Worte, die all diese schönen Erinnerungen in mir wiedererweckt haben, die unter einer dicken Schicht aus Pflichten und Verantwortungen begraben gewesen waren. Das wiederum erinnert mich an die weisen Worte von Eduardo Galeano, dem großen uruguayischen Schriftsteller: »Leben nur, um zu leben, so wie der Vogel singt, ohne zu wissen, dass er singt, oder das Kind spielt, ohne zu wissen, dass es spielt.« Und noch etwas muss ich gestehen: Seit ich dieses Buch gelesen habe, macht mir das Fahrradfahren wieder Spaß.
Ich möchte mit den Worten schließen, dass dies ein inspiriertes und einfallsreiches Buch ist, humanistisch und doch unangepasst, intellektuell und doch empirisch, rigoros und doch liebevoll, kultiviert und doch zugänglich, weltlich und doch spirituell. Vor allem aber ist es ein Buch über Zen, dessen – wie dieses Buch uns erinnert – einfachste, anspruchsvollste und zugleich auch am schwersten verständliche Maxime lautet: »Wenn ich esse, esse ich. Wenn ich schlafe, schlafe ich.« Ich möchte hinzufügen: »Wenn ich Fahrrad fahre, fahre ich Fahrrad.«
Joan Garriga Bacardi
Port de la Selva
Humanistischer Psychotherapeut,
Gründer des Institut Gestalt in Barcelona,
Pionier der Familienaufstellung nach Bert Hellinger
in Spanien und Lateinamerika sowie Buchautor

EINFÜHRUNG
Ein wunderbares Gefühl des Nichts
Wenn du jemals auf dein Fahrrad gestiegen und losgefahren bist und das Gefühl hattest, deine Handlungen seien unabhängig von deinem Willen und all dein Denken würde vorübergehend pausieren, dann brauche ich dir wohl nicht zu erklären, was ich mit »Gefühl des Nichts« sagen will. Im Zen bezeichnet man diesen Zustand als Achtsamkeit.
Eines Mittags Ende 1982, ich war 38 Jahre alt, bemerkte ich, dass Fahrräder sich selbst lenken. Ich sitze am Strand mit Blick auf den Rio de la Plata, dort, wo sich heute der Jardín de la Memoria befindet. Bei mir ist Daniel Coifman, ein Freund und Psychotherapeut, der mehrere Aufenthalte am Esalen Institute in Big Sur absolvierte, mehrfach nach Indien reiste und, um es kurz zu fassen, die Geheimnisse des Bewusstseins erkundet hat. Unsere Fahrräder lehnen aneinander.
Ich erzähle ihm, dass ich mich an all die Orte erinnere, durch die wir zusammen gefahren sind: das Planetarium, den Bahnübergang beim Flughafen, die Kreuzung beim Fischerverein. Und auch an den Wind auf meinem Gesicht, das Wasser, das gegen die Brüstungen spritzte, den Essensgeruch in den Restaurants, wie du einen Umweg gefahren bist, um den beiden alten Herren aus dem Weg zu gehen, die Mate tranken … Aber ich kann mich einfach nicht daran erinnern, was ich dabei gedacht habe. Ich war abgelenkt, keine Ahnung, wo ich in Gedanken war. Ich weiß nur, dass ich jetzt hier bin.

Daniel springt auf. »Nein, du warst nicht abgelenkt«, sagt er. »Du warst geistes abwesend, aber nicht abwesend. Und ob du es glaubst oder nicht, das ist das genaue Gegenteil.«
Читать дальше