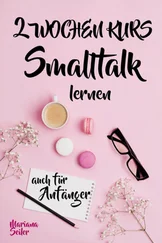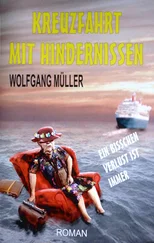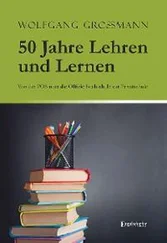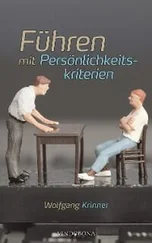34Vgl. Afonso 2013.
35Vgl. Afonso 2013, 220 u. 224; Afonso 2014, 161 f. u. 164.; Afonso 2015, 270.
36Vgl. Afonso 2010, 124 f.
37Vgl. Buchberger 2018, 152–154. Vgl. auch Kapitel VII.1 „Ergebnisse der Primarstufe“.
38Vgl. Buchberger 2019. Vgl. auch die Zahlen zu Perspektivität im Rahmen dieser Untersuchung im Kapitel VII „Ergebnisse“.
39Vgl. Fiebig 2013.
40Vgl. dazu Fiebig 2013, 235 f. Das Verfahren muss an einigen Stellen als hoch-inferent eingestuft werden, da es stark abhängig von individuellen Beobachtungsmaßstäben ist. (vgl. ebda) Deutlich wird dies z. B. bei folgendem Kriterium aus dem Ratingbogen: „Die Arbeitsaufträge sind klar und präzise formuliert.“ Wenngleich einige der Analysekategorien mit Blick auf deren Operationalisierbarkeit bzw. intersubjektive Nachvollziehbarkeit optimierbar erscheinen, handelt es sich um ein Untersuchungsinstrument, das viele der aus der geschichtsdidaktischen Literatur ableitbaren Gütekriterien berücksichtigt, die auch in der vorliegenden Arbeit zum Einsatz kommen.
41Vgl. Fiebig 2013, 311.
42Vgl. Beilner 2002, 95 f.; Beilner 2004, 103. Beilner spricht von „unkritischer Dokumentengläubigkeit“ der Proband*innen der 6. Schulstufe (Ebda). Vgl. auch Langer-Plän 2003, 334.
43Vgl. Langer-Plän 2003, 323.
44Vgl. Beilner 2002, 86.
45Vgl. Langer-Plän 2003, 335 f. Sie konnte 13 von 54 Schüler*innen der 9. Schulstufe mit falschen Erklärungen für den Quellenbegriff und acht mit sowohl richtigen als auch falschen Beispielen identifizieren, während 19 Schüler*innen als Erklärung nur Beispiele nannten. 13 Proband*innen gaben zutreffende Erklärungen ab. Auch andere empirische Ergebnisse lassen erkennen, dass konzeptionelles Wissen im Umgang mit Quellen bei vielen Lernenden der Sekundarstufe sehr basal ausgeprägt ist: Vgl. zur festgestellten Tendenz bei Schüler*innen, historische Quellen unkritisch als Informationen und Zeugnisse der Vergangenheit zu behandeln Afonso 2013, 238. Vgl. auch die fehlende Unterscheidung von Quelle und Darstellung in der Praxis bei Lernenden Martens 2010, 294. Vgl. zur Vorstellung der Objektivität von Quellen bei Lernenden Borries 2005, 71 f.
46Dieser Zugang ist mit Blick auf zu fördernde Re-Konstruktionskompetenzen durchaus diskussionswürdig, da keine Quellenkritik angeleitet wird, sondern die Bearbeitung entlang der Aufgabenstellungen auf einer reproduktiven Ebene verbleibt und die Quelle somit unkritisch als „Fenster in die Vergangenheit“ genutzt wird. Weitere Materialien zur historischen Kontextualisierung werden nicht zur Verfügung gestellt.
47Vgl. Sauer/Wolfrum 2007, 89 f.
48Sauer/Wolfrum 2007, 96.
49Sauer/Wolfrum 2007, 98.
50Vgl. Sauer/Wolfrum 2007, 95 u. 97 f.
51Vgl. Sauer/Wolfrum 2007, 100.
52Vgl. Sauer 2013, 179 f.
53Vgl. Sauer 2013, 180 f. In der schriftlichen Befragung gaben die Lehrer*innen an, dass mit Abstand die meisten der im Unterricht eingesetzten Textquellen aus dem Schulbuch kommen: vgl. Sauer 2013, 190.
54Vgl. Sauer 2013, 184 u. 186 f..
55Vgl. Sauer 2013, 197.
56Vgl. u. a. Bramann 2018, Becher/Gläser 2017, Heuer 2017, Lankes/Thünemann 2017, Bernhard 2016, Mägdefrau/Michler 2014, Thünemann 2013, Waldis 2013, Waldis et al. 2012, Mägdefrau/Michler 2012, Wild 2012, Brauch et al. 2011.
57Vgl. die jüngeren Ergebnisse bei Bramann 2018, 194 und Lankes/Thünemann 2017, 950 f.
58Vgl. Hölscher 2013, 177–180.
59Vgl. Bramann/Kühberger 2019.
60Vgl. zu den Arbeiten zum Schulbuchverständnis Borries 2005; Meyer-Hamme 2011. Vgl. zu Hinweisen zur Schulbuchgestaltung z. B. Zülsdorf-Kersting 2011.
„Es geht wirklich ins Komische, wenn man (…) von längst Vergangenem sich mit Gewißheit überzeugen will.“ 61 (Johann Wolfgang von Goethe)
III. Dimensionen des Historischen Lernens
III.1 Historisches Lernen
Im Rahmen einer Schulbuchanalyse, die grundgelegte Möglichkeiten historischen Lernens untersuchen möchte, ist es unumgänglich, normative Gesichtspunkte historischen Lernens zu benennen 62 , die Aufschluss darüber geben, welche Ziele denn eigentlich erreicht werden sollen. 63 Speziell mit Blick auf den Umgang mit Textquellen im schulischen Unterricht postuliert Pandel als Ziel des historischen Lernens im Geschichtsunterricht: „Historisch denken zu lernen.“ 64 Aber was genau bedeutet es, historisch zu denken und wie kann man es lernen? Welche konkreten Operationen historischen Denkens sind für die Untersuchung des Umgangs mit Textquellen in Schulbüchern relevant?
In der Geschichtsdidaktik als „Wissenschaft vom historischen Lernen“ 65 besteht heute Einigkeit darüber, dass es im Geschichtsunterricht 66 um mehr gehen muss als um die Vermittlung auswendigzulernender Wissensbestände über die Vergangenheit. Als Ziel wird vielmehr die Förderung und Entwicklung eines reflektierten und (selbst-)reflexiven Geschichtsbewusstseins ausgewiesen. Vor bereits mehr als 40 Jahren sieht Jeismann als den Kern der geschichtsdidaktischen Wissenschaftsdisziplin das „Geschichtsbewusstsein in der Gesellschaft“ 67 . Geschichtsbewusstsein ist für ihn der innere „Zusammenhang von Vergangenheitsdeutung, Gegenwartsverständnis und Zukunftsperspektive“ 68 . Auch Rüsen fordert die Hinwendung zum Geschichtsbewusstsein als „Basis allen historischen Lehrens und Lernens“ 69 :
„Die oberste Qualifikation, die durch das historische Lernen erreicht werden soll, ist eben die Fähigkeit des Geschichtsbewußtseins, Sinn über Zeiterfahrung bilden zu können, um sich erfahrungsgestützt im Zeitverlauf der eigenen Lebenspraxis absichtsvoll orientieren zu können. Um eben dieser Fähigkeit willen, wird das Geschichtsbewußtsein in den mühsamen Prozessen menschlicher Individuierung und Sozialisation ausgebildet. Dieses oberste Lernziel, diese fundamentale Qualifikation, läßt sich in präziser Zuspitzung auf das, was es grundsätzlich heißt, historisch zu lernen, als ‚narrative Kompetenz‘ bezeichnen.“ 70
Geschichtsbewusstsein ist hier als „Inbegriff der mentalen Operationen“ 71 oder Bewusstseinstätigkeiten eines jeden Individuums zu verstehen, um sich über sinnbildende Zeiterfahrung 72 im Umgang mit den Zeitebenen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu orientieren, indem es „sich auf Vergangenheit und Zukunft bezieht und beide in ein Verhältnis setzt“ 73 . Zentral für dieses anthropologische Bedürfnis, sich zu orientieren 74 – um durch immer wieder neu zu leistende zeitliche Orientierungsprozesse Kontingenzerfahrungen zu bewältigen 75 –, zentral für diese „Grundausstattung menschlichen Denkens“ 76 ist laut Rüsen das historische Erzählen. Für ihn lässt sich historisches Lernen „als Bildung von Geschichtsbewusstsein durch Erzählen thematisieren“ 77 . Dahinter steht die narrativistische Geschichtstheorie als „ein Ergebnis wissenschaftsphilosophischer wie fachdidaktischer Reflexionen und Forschungen zur Funktion von Geschichte für das Leben der Individuen und menschlicher Gesellschaften, zu den Bedingungen und Möglichkeiten, Prinzipien und Verfahren historischer Erkenntnis und zu den Formen und Funktionen historischen Wissens“ 78 . Grundlegend dabei ist einerseits, dass historische Erkenntnis in Form von Geschichte immer eine narrative Struktur aufweist, also erzählt wird, 79 und andererseits die erkenntnistheoretische Unterscheidung zwischen Vergangenheit und Geschichte. Im Zusammenhang mit Zweiterem wird deutlich, dass auf der Grundlage dieses dem gemäßigten Konstruktivismus zuzuordnenden narrativistischen Geschichtsverständnisses zwischen der abgeschlossenen, unwiederbringlichen Vergangenheit einerseits und ihrer Re-Konstruktion in Form von Geschichten andererseits unterschieden wird. 80 Vergangenheit steht hier also für die als solche nicht erfassbare Wirklichkeit früherer Zeiten und Geschichte für die notwendigerweise narrative Form, in der diese Vergangenheit partikular als Ergebnis historischer Denkprozesse auf vielfältige Weise dargestellt werden kann. Dies bedeutet eine Überholung der älteren Vorstellung, dass Geschichte ein ein für alle Mal feststehender, wenn auch durch Forschung erweiterter Bestand von deklarativem Wissen über die Vergangenheit ist. Das bedeutet auch, dass die prinzipielle Mehrzahl von (teilweise) konkurrierenden, aber triftigen 81 , also plausiblen Geschichten über die Vergangenheit (entgegen eines theorie- und methodenlosen Relativismus) anerkannt wird und somit als verbindlich gelten wollende Masternarrative zu hinterfragen sind. 82
Читать дальше