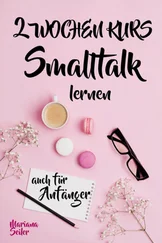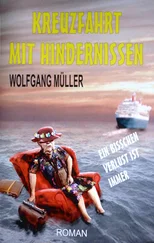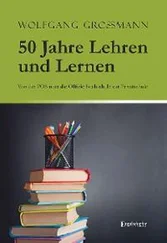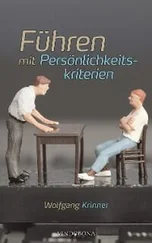Wie deutlich geworden sein sollte, handelt es sich bei den Kompetenzen, „die im Umgang mit Quellen erworben werden bzw. die für einen angemessenen Umgang mit Quellen ausschlaggebend sein sollen, letztlich um konzeptionelle Übersetzungen geschichtstheoretischer Konzepte, die auf der Ebene schulischer (und im Sinn der FUER-Gruppe auch außerschulischer) Geschichtsvermittlung ablaufende Prozesse und Minimalanforderungen beschreiben“ 150 . Im Umgang mit Textquellen betrifft das die synthetischen Prozesse der Re-Konstruktion von Vergangenem. Re-Konstruktion bedeutet demnach im Kontext von FUER „die von einer Fragestellung geleitete Erschließung vergangener Phänomene […] mit Hilfe von Quellen“ 151 . Dabei spielen Heuristik, Quellenkritik und Quelleninterpretation eine Rolle, allesamt mit dem Ziel der Erstellung einer kontextualisierenden historischen Narration. 152 Aus dem FUER-Modell – hier aus der Kernkompetenz der methodisch regulierten Re-Konstruktion – können folglich zum Umgang mit Textquellen die beiden folgenden Einzelkompetenzen 153 abgeleitet werden:
• Quellen und Darstellungen hinsichtlich ihrer Charakteristika unterscheiden
• Anhand eines Leitfadens Textquellen beschreiben, analysieren und interpretieren
Ausgehend von der Unterscheidung zwischen Quelle und Darstellung sollen im Rahmen eines Re-Konstruktionsprozesses Textquellen beschrieben, analysiert und interpretiert werden. 154 Im Bereich der Beschreibung bzw. der Erschließung von Quellen sind sowohl Aspekte der Heuristik (z. B. Suche nach den für die Beantwortung der Frage geeigneten Quellen), der äußeren Quellenkritik (z. B. Authentizität der Quelle) als auch der inneren Quellenkritik (z. B. Zusammenfassung des Inhalts als Voraussetzung für die Analyse) zu verorten. In den Bereich der Analyse von Textquellen fallen v. a. Aspekte der inneren Quellenkritik wie die Untersuchung von Sprache, Intention/Absicht, dahinter liegende Perspektiven/Weltbilder/Interessen, vom Verhältnis zu Empfänger*innen oder dem historischen Kontext der Quelle. Diese analytischen Aspekte innerer Quellenkritik spiegeln sich etwa in folgenden Einzelkompetenzen wider:
• Gattungsspezifik für die Arbeit mit der Quelle berücksichtigen
• Die unumgängliche Perspektivität von Textquellen feststellen
• Die Intention von Textquellen feststellen
Im Bereich der Interpretation als dem letzten Teilschritt des Prozesses der Quelleninterpretation stehen die historischen Narrationen als Antworten auf Fragen an die Vergangenheit auf der Grundlage von Analyseergebnissen im Zentrum:
• Aus den Ergebnissen der Quellenarbeit (und Erkenntnissen von Darstellungen) eine selbstständige historische Narration erstellen
• Erstellen verschiedener Darstellungsarten (z. B. Sachtext, Plakat, Video) zur gleichen Materialgrundlage erproben
Überlappungsbereiche ergeben sich sowohl zu den prozeduralen Kompetenzbereichen historische Frage- und Orientierungskompetenzen als auch zu den historischen Sachkompetenzen. Im Bereich der historischen Fragekompetenzen stehen Orientierungsbedürfnisse berücksichtigende und Leseabsicht festlegende – auch als Teil der der Heuristik zu verstehende – Fragen an die Vergangenheit im Mittelpunkt:
• Fragen an historische Textquellen stellen
• Eigenständige Fragen an die Vergangenheit (zu Entwicklungen) entlang einer Textquelle formulieren
Wenn auch Gegenwartserfahrungen und Zukunftserwartungen explizit in diesem Sinnbildungsprozess miteinbezogen werden, müssen Einzelkompetenzen der historischen Orientierungskompetenzen fokussiert werden:
• Erkenntnisse von eigenen und fremden Darstellungen zur individuellen Orientierung hinsichtlich der Bewertung der Vergangenheit und möglicher Handlungsoptionen in der Gegenwart und Zukunft nutzen
• Über die (persönliche) Nutzung von historischen Erkenntnissen zur individuellen Orientierung in der Gegenwart und Zukunft reflektieren
Wesentlich ist, dass die Fähigkeit des kritischen und eigenständigen Umgangs mit Vergangenheit (und Geschichte) die Kenntnis von und den Umgang mit dem methodengeleiteten Prozess historischen Erkenntnisgewinns voraussetzt: „Ohne diese historischen Kompetenzen können der eigene Umgang mit Vergangenheit und Geschichte, also das eigene historische Denken, die eigenen Fragebedürfnisse, Erzählungen, Theorien weder begründet, geschweige denn verändert werden.“ 155 Es braucht daher die Kenntnis und Anwendung historischer Erkenntnisverfahren und somit die Heranführung an den Prozess der Re-Konstruktion vergangener Wirklichkeit (neben der Befähigung, geschichtskulturelle Produkte zu analysieren). 156
Dabei ist entgegen eines Methodenlernens fern von der Grammatik historischen Denkens mehr nötig als die Kenntnis des regelgeleiteten methodischen Umgangs mit unterschiedlichen Textquellenarten, da ebenso deutlich werden muss, inwiefern Interpretationsprozesse zur Bearbeitung historischer Fragen eingesetzt werden und welche Bedeutung diese für historische Orientierung haben können. 157 Schüler*innen können durch Interpretationen von historischen Quellen lernen, wie Geschichte gemacht wird, und reflektieren ferner die Voraussetzungen historischer Erkenntnis- und Sinnbildungsprozesse. 158
III.4 Historisches Lernen mit Schulbüchern
Ausgehend vom Ziel des Geschichtsunterrichts, historisches Denken zu lernen, sind auch Schulbücher als Medien historischen Lernens zu verstehen. 159 Solcherart müssen sie in ihrer Gestaltung bestimmte Merkmale aufweisen, die dazu geeignet sind, Kompetenzen des historischen Denkens im Umgang mit Textquellen anzubahnen. 160
Laut Bodo von Borries wird „Geschichtsunterricht […] nicht anhand fachdidaktischer Konzeptionen und Grundsatzerklärungen erteilt, sondern anhand von Geschichtsbüchern […].“ 161 Dies bestätigen auch neuere Untersuchungen zur Bedeutung des Schulbuchs im Unterricht (CAOHT) 162 Nach Jörn Rüsen ist für ein ideales Schulgeschichtsbuch ausschlaggebend, dass es seinen wesentlichen Zweck erfüllt, nämlich „historisches Lernen zu ermöglichen, zu initiieren und zu fördern.“ 163 Das „Hauptbeurteilungskriterium“ für ein Geschichtsschulbuch muss also „seine Eignung für die Anbahnung und erfolgreiche Durchführung historischer Lehr-/Lernprozesse“ sein. 164 Es lohnt sich daher einen Blick auf Meilensteine der geschichtsdidaktischen Schulbuchanalyse-“Kriterienbündel“ 165 zu werfen (Bodo von Borries 1980, Jörn Rüsen 1992, Alexandra Binnenkade und Peter Gautschi 2003, Alexander Schöner und Waltraud Schreiber 2006), um daraus Forderungen abzuleiten, wie Schulbücher beschaffen sein müssen, damit historische Lehr-/Lernprozesse initiiert werden können.
Um die Grundlagen für historisches Lernen zu ermessen, werden in diesen Arbeiten unterschiedlichste Kriterien genannt, 166 wie z. B. die Relevanz von (historischen) Fragen, 167 Aspekte wie Multiperspektivität und Kontroversität, 168 Kohärenzen zwischen Autorentext und Materialien bzw. Kohärenzen zwischen einzelnen Arbeitsmaterialien (Quellen und Darstellungen), 169 Offenheitsgrade von Aufgabenstellungen und unterschiedliche kognitive Anforderungsbereiche, 170 Differenzierungsmöglichkeiten, 171 Gegenwarts- und Lebensweltbezüge oder Orientierungsbedürfnisse 172 usw.
Da es in der vorliegenden Untersuchung von Schulbüchern um den Umgang mit Textquellen geht, reduziert sich die nun folgende Auswahl von Qualitätskriterien auf den Einsatz von Quellen. Zum Umgang mit Quellen als Grundlage historischen Lernens schreibt etwa Rüsen: „Brauchbar ist ein Schulbuch dann, wenn mit ihm im Unterricht wirklich gearbeitet werden kann. Der Arbeitsbuchcharakter ist also unverzichtbar.“ 173
• Quellenarbeit als unverzichtbare Voraussetzung
Zur Arbeit mit Quellen 174 im Speziellen meint Borries: „Das Schulbuch muß die Form einer ‚untersuchenden Darstellung‘ (Droysen 61971, 286 ff.), also einer Arbeit mit den Quellen haben.“ 175 Einschränkend fügt er hinzu: „Quellenarbeit kann leicht als das eigentliche Ziel, als der Zweck der Geschichtswissenschaft (und des Geschichtsunterrichts) verkannt werden. Allenfalls im Sinne einer antiquarischen Geschichtsbetrachtung wäre das zutreffend; für Geschichtsunterricht ist es nicht akzeptabel. […] Quellenkritik ist nicht Selbstzweck […]. Die Quellenarbeit ist im Unterricht dadurch gerechtfertigt, daß Untersuchungsprozesse durchgeführt und nicht Untersuchungsergebnisse rezipiert werden sollen.“ 176 Quellen, so wird zudem gefordert, müssen als solche klar erkennbar (z. B. vom Darstellungsteil abgegrenzt) 177 und ausreichend ausgewiesen sein, 178 damit auch quellenkritisch gearbeitet werden kann.
Читать дальше