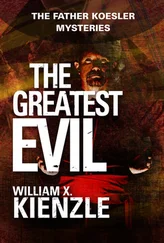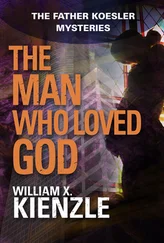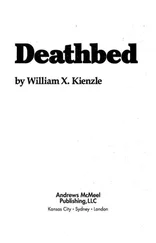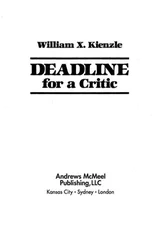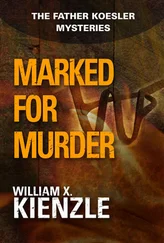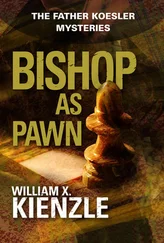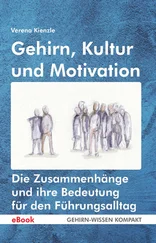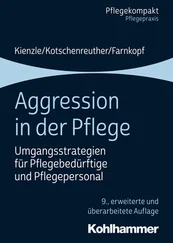• Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG),
• bei minderjährigen Auszubildenden das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG),
• bei (möglichen) schwangeren Auszubildenden das Mutterschutzgesetz (MuSchG),
• Vorschriften zum Arbeitsschutz, wie die Unfallverhütungsvorschriften (UVV), das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und andere sowie
• das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) und
• das Bundesurlaubsgesetz (BUrlG).
Zusätzlich und ergänzend gelten die jeweiligen Tarifverträge.
Oberstes Gebot sollte für die Pflegekräfte neben der Beachtung des Selbstbestimmungsrechts auch die Patientensicherheit sein. Die Rechtsvorschriften dazu finden sich
• im Infektionsschutzgesetz (IfSG),
• als Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes die Verordnungen zur Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen sowie
• Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert-Koch-Institut (KRINKO) und
• dem Strafrecht.
Im Falle der Verletzung von Hygienevorschriften kann die jeweilige Pflegefachkraft auch persönlich über das Haftungsrecht zur Verantwortung gezogen werden.
2.4 Strafrecht (Grundlagen)
Indirekt dienen dem Schutz der Patienten die in der Pflege wichtigen strafrechtlichen Vorschriften. An dieser Stelle soll nur eine kurze Einführung in das Strafrecht erfolgen. Dies soll in späteren Kapiteln bei den Themen Kindesmissbrauch, 17 Gewalt, 18 freiheitseinschränkende Maßnahmen 19 etc. jeweils vertieft werden.
Bei bestimmten Handlungen besteht die Möglichkeit, dass Pflegende strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.
Grundlage des Strafrechts ist das Strafgesetzbuch (StGB) mit dem allgemeinen und dem besonderen Teil. Daneben existieren noch verschiedene Nebengesetze, die gleichfalls Straftatbestände enthalten, wie z. B. das
• Betäubungsmittelgesetz (BtMG),
• Straßenverkehrsgesetz (StVG),
• Arzneimittelgesetz (AMG) und das
• Infektionsschutzgesetz (IfSG).
Allen diesen Gesetzen ist gemeinsam, dass ein von der Gesellschaft missbilligtes Fehlverhalten mit Geld oder Freiheitsstrafen geahndet wird. Es gilt im deutschen Strafrecht der Grundsatz, dass eine Strafe ohne geschriebenes Recht, d. h. ohne Gesetz, nicht möglich ist (§ 1 StGB).
Eine Straftat liegt nur dann vor, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind, d. h. durch eine Person eine
• tatbestandsmäßige,
• rechtswidrige und
• schuldhafte Handlung erfolgt.
Jede Straftat setzt sich somit aus den drei Elementen zusammen:
• Tatbestand:
− objektiver Tatbestand,
− subjektiver Tatbestand,
• Rechtswidrigkeit und
• Schuld.
Nur wenn alle drei Voraussetzungen vorliegen, kann eine Strafe verhängt werden.
Zur Verwirklichung des Tatbestandes einer Vorschrift, beispielsweise der Körperverletzung (§ 223 StGB), muss der Wortlaut der Vorschrift durch die menschliche Handlung verwirklicht werden:
 § 223 StGB
§ 223 StGB 
Wer einen anderen körperlich misshandelt oder an der Gesundheit beschädigt, wird mit Freiheitsstrafe […] oder mit Geldstrafe bestraft.
Es müssen die Tatbestandsmerkmale Misshandlung oder Gesundheitsschädigung erfüllt sein.
Dies ist besonders bei Tatbeständen mit verschiedenen Merkmalen wichtig, denn das Fehlen eines Tatbestandsmerkmals führt dazu, dass eine Bestrafung ausscheiden muss.
Der objektive Tatbestand ist die Beschreibung des äußeren Erscheinungsbildes.
Der objektive Tatbestand ist erfüllt, sofern das Handeln des Täters der Beschreibung im Gesetz entspricht. Das Strafgesetzbuch (StGB) legt die wichtigsten Straftatbestände fest. Die dort genannten Tatbestände werden von der Gesellschaft als diejenigen angesehen, die die Rechtsgüter der Allgemeinheit schützen sollen. Objektive Tatbestände sind beispielsweise »Körperverletzung«, »Mord«, »Nötigung« und »Tötung auf Verlangen«.
Es werden beim Tatbestand zwei Formen der Tatbegehung unterschieden. Ein Tatbestand kann
• entweder durch Tun oder
• durch Unterlassen verwirklicht werden.
Eindeutig ist die Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun, somit durch eine bestimmte Handlung, beispielsweise Verletzung eines Patienten. Wer einen anderen durch aktives Tun schädigt, hat dafür einzustehen, sofern damit ein Straftatbestand, beispielsweise die Misshandlung eines Menschen, verwirklicht wird. Die Beurteilung, ob eine Strafbarkeit wegen einer Unterlassung besteht, ist rechtlich schwieriger. Unterlassen bedeutet, dass eine bestimmte Folge für einen Mitmenschen nicht verhindert wird, obwohl dies möglich gewesen wäre und obwohl ein Handeln erforderlich war.
So ist die Körperverletzung oder die Tötung sowohl durch eine aktive Handlung, ein Tun als auch ein Unterlassen, eine strafbare Passivität möglich. Die strafbare Passivität liegt vor, wenn beispielsweise die Pflegende Maßnahmen nicht ergreift, einen Bewohner bzw. Patienten vor Gefahren zu schützen, obwohl dies möglich und zumutbar gewesen wäre.
Ein Unterlassen ist nach § 13 StGB nur dann strafbar, wenn eine Verpflichtung zum Tätigwerden besteht, der »Täter« also Maßnahmen hätte treffen können und müssen. Es muss deshalb eine so genannte Garantenstellung vorliegen, aus der sich dann die Garantenpflicht (eine »Hilfspflicht«) ergibt.
Die Garantenstellung kann sich aus dem Gesetz (beispielsweise Eltern für ihre Kinder, hoheitlich tätige Personen) oder aus dem Vertrag (z. B. Heimvertrag oder Krankenhausvertrag in Verbindung mit dem Arbeitsvertrag) ergeben. Pflegekräfte haben zumindest aufgrund des Krankenhaus- oder Heimvertrages in Verbindung mit ihrem Arbeitsvertrag eine derartige Garantenstellung. Daraus ergibt sich die Garantenpflicht, gesundheitliche Schäden der Bewohner bzw. Patienten zu verhindern. Hierzu zählt auch die Verhinderung eines Suizides, die Schädigung durch einen Verkehrsunfall oder durch Kälteeinwirkung.
Die inneren Vorgänge im Täter werden vom subjektiven Tatbestand erfasst. Dazu zählen
• der Vorsatz bei Vorsatzdelikten und
• die Fahrlässigkeit bei Fahrlässigkeitsdelikten.
Es gibt in einzelnen Vorschriften daneben noch weitere subjektive Merkmale, wie die Absicht des Betrügers, sich einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Sofern das Gesetz nichts anderes aussagt, ist jedoch nur vorsätzliches Handeln strafbar.
Mit Vorsatz handelt derjenige, der den objektiven Tatbestand mit Wissen und Wollen verwirklicht. Der Täter weiß daher, dass er eine strafbare Handlung begeht und will diese auch begehen, um den strafbaren Erfolg herbeizuführen.
Für Pflegende sind folgende Vorsatzdelikte bedeutsam:
 § 211 StGB
§ 211 StGB 
(1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.
(2) Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.
Читать дальше
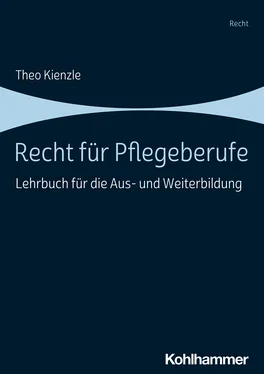
 § 223 StGB
§ 223 StGB