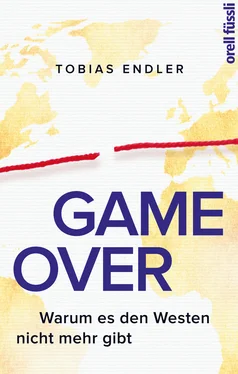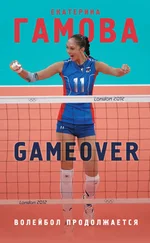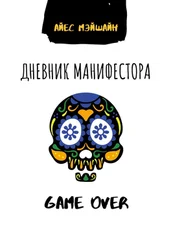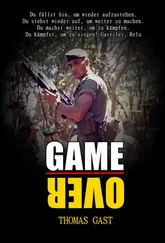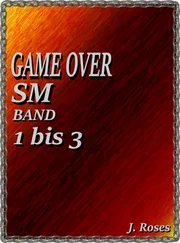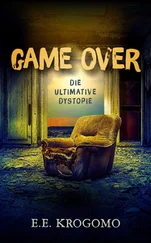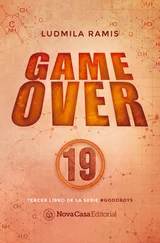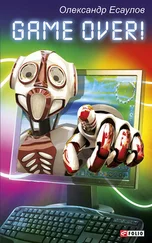Der zweite Grund ist sehr viel jünger. Er ist im Verlauf der letzten zwanzig Jahre bedeutend geworden und hat mit dem gegenwärtigen Naturell der USA zu tun. Die Rolle und der Einfluss der Massenmedien auf den öffentlichen Meinungsbildungsprozess hat eine Dimension erreicht, die zur Jahrtausendwende nicht vorstellbar war. Ganz zu schweigen von den 60er- und frühen 70er-Jahren, also der Zeit, in der ein Großteil derjenigen geboren wurde, die heute den harten Kern der Trumpianer ausmachen. »Das Medium ist die Botschaft«, so hatte es 1962 der kanadische Medienphilosoph Marshall McLuhan ausgerufen. McLuhan war seinerzeit der Superstar seiner Zunft. Jenseits davon hielten ihn viele für einen Spinner, manche für einen Visionär. Sicher ist: Er hätte sich die enorme Diversifizierung und Öffnung der Medienlandschaft in den digitalen Raum hinein nicht vorstellen können. Für die nachfolgende Generation ist es schlicht die Welt, in der wir leben.
Das Dauerfeuer medialer Inszenierung lässt die Menschen nicht mehr zur Ruhe kommen. Beim für amerikanische Verhältnisse gemäßigten Nachrichtensender CNN ist beinahe alles breaking news . Dementsprechend fallen Aufmachung, Tempo und musikalische Untermalung zu den Meldungen des Tages aus. Im Vergleich zur Konkurrenz bei Fox News wirkt CNN beinahe bieder. Auch ein Grund, warum Fox in den USA deutlich mehr Zuschauer hat – die ausschließlich Fox sehen, also ganz bewusst niemals CNN einschalten. So kommt es zum Tunnelblick auf Politik und Gesellschaft. Beide TV-Sender verblassen im Vergleich zur Reichweite der Talk Radios. Eine US-amerikanische Spezialität, wo größtenteils konservative Kommentatoren ununterbrochen ihre persönliche – und offen parteiische – Sicht auf das politische Geschehen feilbieten. Die Rush Limbaugh Show hat ca. 15 Millionen Zuhörer pro Woche. Limbaugh und seine Kollegen kennen ihr Publikum genau und beschallen es rund um die Uhr, inklusive der Werbeblöcke, die sie gleich miteinsprechen.
Schließlich sind in den letzten beiden Jahrzehnten Giganten auf dem Feld der Sozialen Medien herangewachsen, die kaum jemand auf der Rechnung hatte. Die Tech-Riesen Facebook, Amazon, Apple und Google (bzw. dessen Muttergesellschaft Alphabet) bewegen sich in einer eigenen Umlaufbahn, bislang scheinbar jenseits politischer Kontrolle. Doch nun wird dieser Tage ihre Rolle und Reichweite in den westlichen Demokratien kritisch durchleuchtet. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sah sich vor dem US-Kongress einer stundenlangen Befragung ausgesetzt, nicht zuletzt, weil es berechtigten Grund zur Annahme gibt, dass sein Imperium bei den Wahlen 2020 erneut mitentscheidend sein könnte. Dabei hat sich Facebook nie im demokratischen Prozess legitimiert. Es ist, wenn auch häufig so genutzt, keine Informationsplattform. Sondern ein gewinnorientiertes – und börsenorientiertes – Unternehmen. Zuckerbergs Koloss fährt im dritten Quartal 2019 über sechs Milliarden Dollar Gewinn ein. Die großen Vier der Digitalbranche bringen es 2018 auf gewaltige 640 Milliarden Dollar Umsatz. Zum Vergleich: Die Schweiz weist für dasselbe Jahr ein Bruttoinlandsprodukt von rund 700 Milliarden Dollar aus.
Der Einfluss sämtlicher dieser Foren auf ein Land im Dauerwahlkampf ist enorm. Plattformen wie Facebook, YouTube, Tumblr und Instagram versprechen Weltläufigkeit, schließlich sind Neuigkeiten von allen Ecken und Enden des Planeten in Echtzeit verfügbar. Neue und lange Zeit ungekannte Netzwerke grenzüberschreitender Reichweite wachsen rasant. Deren Auswirkungen auf den politischen Prozess sind derzeit noch nicht abschätzbar. Wie Zuckerberg erst unter massivem Druck der Kongressabgeordneten zugibt, nutzen auch demokratiefeindliche Kräfte digitale Foren als Megafon ihrer Botschaften. Facebook hat hier bisher nur Lippenbekenntnisse zu bieten, was deren Eindämmung betrifft. Und sieht offenbar (noch) keinen zwingenden Handlungsbedarf. Warum auch, könnte man fragen, wenn man etwa Zeuge wird, wie der greise Senator Orrin Hatch (mittlerweile aus dem Senat ausgeschieden) Zuckerberg fragt, wie dessen Geschäftsmodell sich ohne Gebühren überhaupt tragen könne. Ein Moment der Heiterkeit, der fehl am Platz ist, schließlich hat Facebook just zu diesem Zeitpunkt ein Datenleck von 87 Millionen Accounts zu verantworten, abgeerntet durch die Beraterfirma Cambridge Analytica, die nichts mit der Eliteuniversität Cambridge, aber einiges mit der passgenauen Modellierung politischer Kampagnen in den USA, Großbritannien und anderswo zu tun hat.
Dieser Dilettantismus der politischen Vertreter/-innen macht es denjenigen, die sie gewählt haben, leicht, sich abzuwenden. Die Institutionen der ältesten existierenden Demokratie der Welt versagen in erschreckendem Maße in ihrer Kontrollfunktion. Von einer moderierenden oder auch nur informierenden Rolle gegenüber dem Volk sind sie gegenwärtig ein ganzes Stück entfernt. Viel zu sehr ist man mit der Fehde zwischen Weißem Haus und Kongress und der eigenen Wiederwahl beschäftigt. Ja, es gibt wichtige Ausnahmen. Da ist die junge Generation engagierter Volksvertreterinnen, die unerschrocken dafür kämpft, dass das moderne Amerika in all seiner Diversität endlich auch im Kongress ein Gesicht bekommt. Die einstige Barkeeperin puerto-ricanischer Herkunft aus der New Yorker Bronx, die offen zu ihrem sozialistischen Politikideal steht und das größte politische Talent ist, das die Demokraten seit Obama hervorgebracht haben. Die erste eingebürgerte Abgeordnete afrikanischer Herkunft, die muslimischen Glaubens ist, und die erste offen bisexuelle Amtsinhaberin, die vorübergehend in ihrem Leben obdachlos war. Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Kyrsten Sinema. Sie alle müssen gegen starke Vorurteile in der Bevölkerung ankämpfen, die ihnen ihre Vorgänger, überwiegend weiße ältere Männer wie der bei seinem Abtritt 84-jährige Hatch, eingebrockt haben. Denn viele Amerikaner außerhalb des Washingtoner Gürtels gehen mittlerweile reichlich desillusioniert davon aus, dass sich dort eine korrupte Kaste aus Politikern, Politikberatern und Lobbyisten ihren Vorteil sichert.
Die Frage liegt nahe, ob wir in diesen Zuständen die eigene Zukunft sehen, wie sie uns mit der üblichen transatlantischen Verzögerung von 5–10 Jahren ins Haus stehen könnte. Eine nicht von der Hand zu weisende Gefahr. Der Wahlkampf 2020 bringt sie ans Licht. Wir sollten genau hinsehen, auch wenn einem dabei manches Mal die Augen schmerzen. Mehr dazu im Kapitel » Wasserscheide« ab Seite 93.
Der dritte Grund, warum Amerika der Welt den Rücken zuwendet: Weil es kann. Die USA sind ein Land von der Größe eines Kontinents, mit der 27-fachen Fläche Deutschlands. Im Osten und Westen schützen Ozeane gegen ungewollte Besucher, im Norden die menschenleeren Weiten der kanadischen Wälder. Mit ihrem riesigen Binnenmarkt kann sich die Nation selbst versorgen. Seit Neuestem ist man auch energieunabhängig: Es muss kein Öl mehr importiert werden. Vier von zehn Amerikanern verlassen die Vereinigten Staaten ihr ganzes Leben lang nicht, jeder zehnte Bewohner nicht einmal den Bundesstaat, in dem er geboren wurde. Dies klingt weniger abwegig als es zunächst scheint, wenn man sich klarmacht, dass Texas alleine größer ist als Frankreich, die Schweiz und die Benelux-Staaten zusammen. Der Luxus, in einem Land dieser Größenordnung zu leben, hat natürlich auch eine Kehrseite. Das Bedürfnis, sich mit der Welt »da draußen«, außerhalb der Landesgrenzen auszutauschen, sinkt. Erfahrungen mit »den anderen« gehen verloren. Das Eigene wird zum absoluten Maßstab – America First.
So gesehen gilt das alte Klischee vom American Exceptionalism , der Einzigartigkeit und Sonderstellung Amerikas, noch immer. Man will aber nicht mehr länger die leuchtende Stadt auf dem Hügel sein. Derart hatten sich die Gründerväter das junge Land einst vorgestellt. The city upon a hill , an der sich die Welt ein Beispiel nimmt. Und faktisch ist der Glanz tatsächlich vielerorts verblasst. Um die Großen Seen herum legt sich der rust belt , der Rostgürtel der alten Industriestaaten Pennsylvania, Ohio, Indiana und Michigan. Bis hinauf ins südliche Wisconsin erstreckt sich die schwer gebeutelte Region, früher das Herz der amerikanischen Stahl- und Fertigungsindustrie. Hier fühlen sich viele Menschen als Verlierer der globalisierten Arbeitsmärkte, überrumpelt von der Wucht der Digitalisierung und ihrem Schicksal überlassen von Washington D.C. Eine ganze Generation nimmt ihr Leben als eine einzige Aneinanderreihung von Krisen wahr: die Terroranschläge vom 11. September 2001, die Immobilien- und Finanzkrise der Jahre 2007/08, die großen Fabriken geschlossen, grassierende Schmerzmittelsucht. Im Frühjahr 2020 dann eine Epidemie, die niemand hat kommen sehen, und die den Menschen brutal den Preis vor Augen führt, den ein auf Sand gebautes Gesundheitssystem im Ernstfall verlangt.
Читать дальше