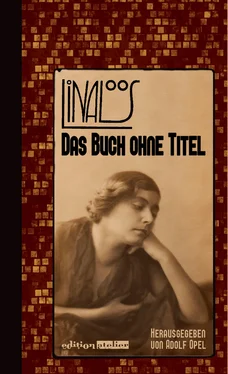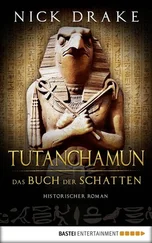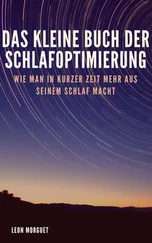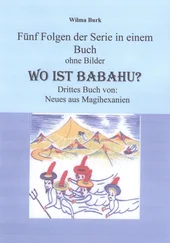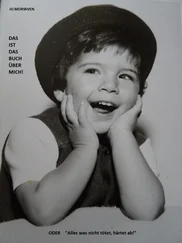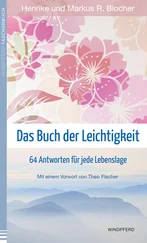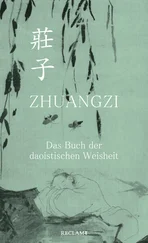Lina Loos - Das Buch ohne Titel
Здесь есть возможность читать онлайн «Lina Loos - Das Buch ohne Titel» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Das Buch ohne Titel
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Das Buch ohne Titel: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Das Buch ohne Titel»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Erstmals 1947 erschienen und nun nach vielen Jahren neu aufgelegt präsentiert «Das Buch ohne Titel» einen unverstellten, direkten Einblick in das Wien ihrer Zeit. Eine elegante, kluge, sinnliche und humorvolle Lebenschronik, reich an Anekdoten, Einsichten und Erinnerungen, die Presse und Publikum begeisterte.
Das Buch ohne Titel — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Das Buch ohne Titel», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Vor allem letzteres dürfte Loos seiner ungetreuen Frau nie mehr verziehen haben. Er schickt sie allein in das Dorf Kals in Tirol, dort, in Quarantäne, soll sie über ihre Lage nachdenken und zur Besinnung kommen. Loos hat sich inzwischen dazu durchgerungen, Lina freizugeben, falls sie sich gegen ihn und für den Jüngeren entscheiden sollte; er teilt seine Absicht Heinz Lang mit, der in Kidderminster bei Birmingham seinen Sommerurlaub bei einer befreundeten Familie verbringt. Lang scheint daraufhin fest damit gerechnet zu haben, dass Lina zu ihm nach England kommen würde – doch diese war offenbar zu dem Entschluss gekommen, ihren eigenen Weg zu gehen und sich von beiden Männern zu trennen. Sie begleitete zwar Loos an den Genfersee, wo ein Auftrag – die »Villa Karma« in Clarens – auf ihn wartete, begab sich aber in die Obhut der befreundeten Laura Beer, der Frau von Loos’ Bauherrn, und trat anschließend – wieder mit finanzieller Hilfe ihrer Mutter, die ihre Unabhängigkeitsbestrebungen von ganzem Herzen unterstützte – einen Kuraufenthalt in Vevey an. Von dort schickte sie einen rekommandierten Absagebrief samt Foto an Heinz Lang; beides erreichte ihn am 27. August 1904. Eine Minute nach Erhalt dieses Briefes – so teilte der mit der Familie Lang befreundete Schriftsteller Stefan Grossmann kurz darauf Lina Loos lakonisch mit – habe sich Heinz Lang in einer Jagdhütte in Falling Sands mit einem Armeerevolver erschossen. Man fand bei ihm Fotos von Lina Loos und einen begonnenen, aber nicht abgeschickten Brief an sie.
Nicht nur die Zeitungen berichteten über die skandalträchtige Affäre, auch in den Wiener Salons wurden der Selbstmord und seine Begleitumstände ausgiebig erörtert. Arthur Schnitzler hat in seinem Fragment gebliebenen Stück Das Wort diesen Fall und die darin verwickelten Personen verfremdet nachgezeichnet; erst 1966 wurde es im »Theater in der Josefstadt« uraufgeführt und 2002 sogar – eine zweifelhafte Hommage – unter Auflösung der von Schnitzler gewünschten Verfremdungen als Affäre Lina Loos in Reichenau gespielt.
Im Jahre 1904 kam es auch zu den ersten Zeitungsveröffentlichungen von Lina Loos. Sie debütierte am 14. August im »Neuen Wiener Tagblatt« mit Vandalen (Brief einer Dame) ; es war tatsächlich ein Brief, den sie an ihren Mann geschrieben hatte: Loos war von dessen Inhalt so angetan, dass er ihn der Zeitung zur Veröffentlichung schickte. Ob das mit ihrem Einverständnis geschehen war, sei dahingestellt – jedenfalls hat Adolf Loos seine Frau in eine schriftstellerische Laufbahn geradezu hineingestoßen. Im selben Jahr publizierte sie auch Aphorismen, sichtlich angeregt durch Peter Altenberg, aber auch Oscar Wilde, dessen geistvolle Aperçus sie mit der Hand abschrieb und zusammen mit anderen »Leseblüten« aufbewahrte.
Für Lina Loos begannen Wanderjahre – offensichtlich wollte sie auch räumlichen Abstand zu den Ereignissen gewinnen, die so großes Leid und Aufsehen verursacht hatten. Die abgeschlossene Schauspielausbildung kam ihr zugute und ein Engagement an das deutschsprachige Irving Place Theater in New Haven, U.S.A., kam zur rechten Zeit: Am 18. Jänner 1905 verließ sie Europa an Bord der »S.S. Deutschland«; in Genua erreichte sie noch ein letzter Brief von Adolf Loos, der möglicherweise noch mit ihrer Rückkehr rechnete, und eine Glückwunschnote von Laura Beer – auch sie eine Selbstmordkandidatin.
Unter dem Pseudonym »Carry Lind« trat sie am 15. März 1905 in Amerika als »Luise« in Kabale und Liebe erstmals auf und konnte einen Erfolg bei Presse und Publikum buchen. Doch es hielt sie nicht lange in der Neuen Welt – und wenn Franz Theodor Csokor Jahrzehnte später schreibt, das Leben von Lina Loos sei zwischen den Fixpunkten New York und Sievering verlaufen, so handelt es sich zweifellos um den liebevollen, aber gar nicht nötigen Versuch, die bewunderte Frau zur Weltbürgerin zu stilisieren. Denn schon nach wenigen Monaten kehrte sie nach Europa zurück und spielte, ihr Pseudonym häufig wechselnd, an diversen Theatern in Norderney, Berlin, Leipzig und St. Petersburg.
Die einverständliche Trennung der Ehe mit Adolf Loos »wegen unüberwindlicher Abneigung« wurde am 19. Juni 1905 gerichtlich bestätigt. Bis 1906 ist Lina Loos noch in der gemeinsamen Wohnung in der Giselastraße gemeldet; drei Jahre später findet sie dann die Wohnung, die bis zu ihrem Tod ihr geliebtes Refugium bleiben soll: in dem eben fertiggestellten Haus in der Sieveringer Straße 107, das ein Mitarbeiter von Adolf Loos, Ernst Epstein – der spätere Bauleiter des »Loos-Hauses« am Michaelerplatz –, entworfen hat. Zunächst nur als Sommerwohnung gemietet und mit den Möbeln ausgestattet, die sie aus der Giselastraße mitnimmt, wird sie nach einer gründlichen Renovierung ab 1911 zu ihrem ständigen Wohnsitz. Die Einrichtung durch Adolf Loos – vor allem die Rekonstruktion des ganz in Weiß gehaltenen Schlafzimmers – dürfte Teil des Arrangements zwischen den Geschiedenen gewesen sein, da Loos ja die mit dem Geld der Obertimpflers finanzierte Wohnung in der Giselastraße für sich behielt.
Für die Schriftstellerin Lina Loos waren die Jahre zwischen 1904 und 1919 wenig ertragreich. Sie wechselt oft die Engagements als Schauspielerin, ein chronisch werdendes Lungenleiden verursacht immer wieder Unterbrechungen ihrer Arbeit. Anfang 1907 muss sie mehrere Monate im Sanatorium Schwarzeck im Schwarzwald verbringen. Im Oktober dieses Jahres ist sie einer der Stars im neueröffneten »Cabaret Fledermaus« in Wien.
Auch 1908, im zweiten Jahr der von der »Wiener Werkstätte« eingerichteten »Fledermaus«, ist Lina Loos als Diseuse und Rezitatorin mit dabei; sie beteiligt sich auch, zusammen mit Friedell, an deren Gastspielen in Deutschland. Zwei Jahre später ist sie am »Linden-Cabaret« in Berlin engagiert und – schon während des 1. Weltkriegs – auch im »Cabaret Simplicissimus« in Wien. Meist tritt sie in diesen Jahren unter dem Künstlernamen »Lina Vetter« auf – was auf einen neuen Mann in ihrem Leben verweist, dem sie sich zugehörig gefühlt hat; auch in der Korrespondenz und in den Anmerkungen Csokors taucht ein »Herr Vetter« auf, dem Lina Loos nahestand.
Die für sie wichtigste Beziehung in jener Zeit bestand aber zweifellos zu Dr. Herbert Fries, einem jungen Anwalt, der wie sie in der Sieveringer Straße wohnte. Bei Ausbruch des 1. Weltkriegs wurde Dr. Fries an die Ostfront geschickt, er fiel schon im ersten Kriegsjahr. Als Csokor, Linas allzeit getreuer Paladin, auf seiner Flucht von Polen nach Rumänien während des 2. Weltkriegs durch Rawa Ruska kam – den Ort, wo Dr. Fries umgekommen war –, versäumte er es nicht, von dort an Lina zu schreiben und ihres toten Verlobten zu gedenken.
Bevor Dr. Fries 1914 zum Militär eingezogen wurde, hatte er noch sein Testament verfasst, das im Falle seines Todes die jährliche Auszahlung einer größeren Summe an Lina Loos vorsah. Sie weigerte sich, dieses Legat anzunehmen.
Lina Loos mag diesen für ihr Unabhängigkeitsstreben so charakteristischen Entschluss später vielleicht bereut haben – denn mit dem Verlust und Verkauf des »Café Casa Piccola« noch vor Ende des Krieges war auch die finanzielle Basis verloren, die ihr – und ihrem Bruder Karl – bisher die ernsthaftesten Existenzsorgen erspart hatte. In späteren Jahren hat sie, wenn es ihr schlecht ging, gelegentliche finanzielle Zuwendungen ihrer Freunde – vor allem Friedell und Csokor – nicht mehr zurückgewiesen.
Ende 1914 wird ihr Lungenleiden wieder akut und die Eltern ermöglichen ihr – zum letzten Mal – einen längeren Sanatoriumsaufenthalt in Davos. Sie genießt diese Zeit in der von allem Kriegsgeschehen abgeschotteten Schweiz so gut es geht, betreibt Wintersport und lässt sich auf ablenkende Flirts mit anderen Patienten ein – doch hinter all diesen Vordergründigkeiten lauert überwältigend die unbarmherzige Dimension des Krieges, die sie nicht wegschieben kann – im Gegensatz zu den anderen Kranken, die fast ausschließlich um ihr jeweiliges Tagesbefinden bangen. Vermutlich haben die Monate in Davos den Anstoß dazu gegeben, dass Lina Loos zur engagierten Schriftstellerin geworden ist. Ab 1919 finden wir Artikel, Aphorismen, Feuilletons und Theaterszenen von Lina Loos mit zunehmender Häufigkeit in Zeitschriften und Tageszeitungen abgedruckt; sie selbst hat diese Arbeiten zunächst vermutlich als willkommenen Extraverdienst und als journalistisches Nebenprodukt einer Schauspielerin taxiert – nie fehlt neben ihrem Autorennamen der stolze Hinweis »Mitglied des Deutschen Volkstheaters« oder, ab 1933, »Mitglied der Scala (Wien)«, Von 1921 bis 1936 ist sie an diesen Theatern, die beide von Direktor Dr. Rudolf Beer geleitet wurden, engagiert.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Das Buch ohne Titel»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Das Buch ohne Titel» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Das Buch ohne Titel» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.